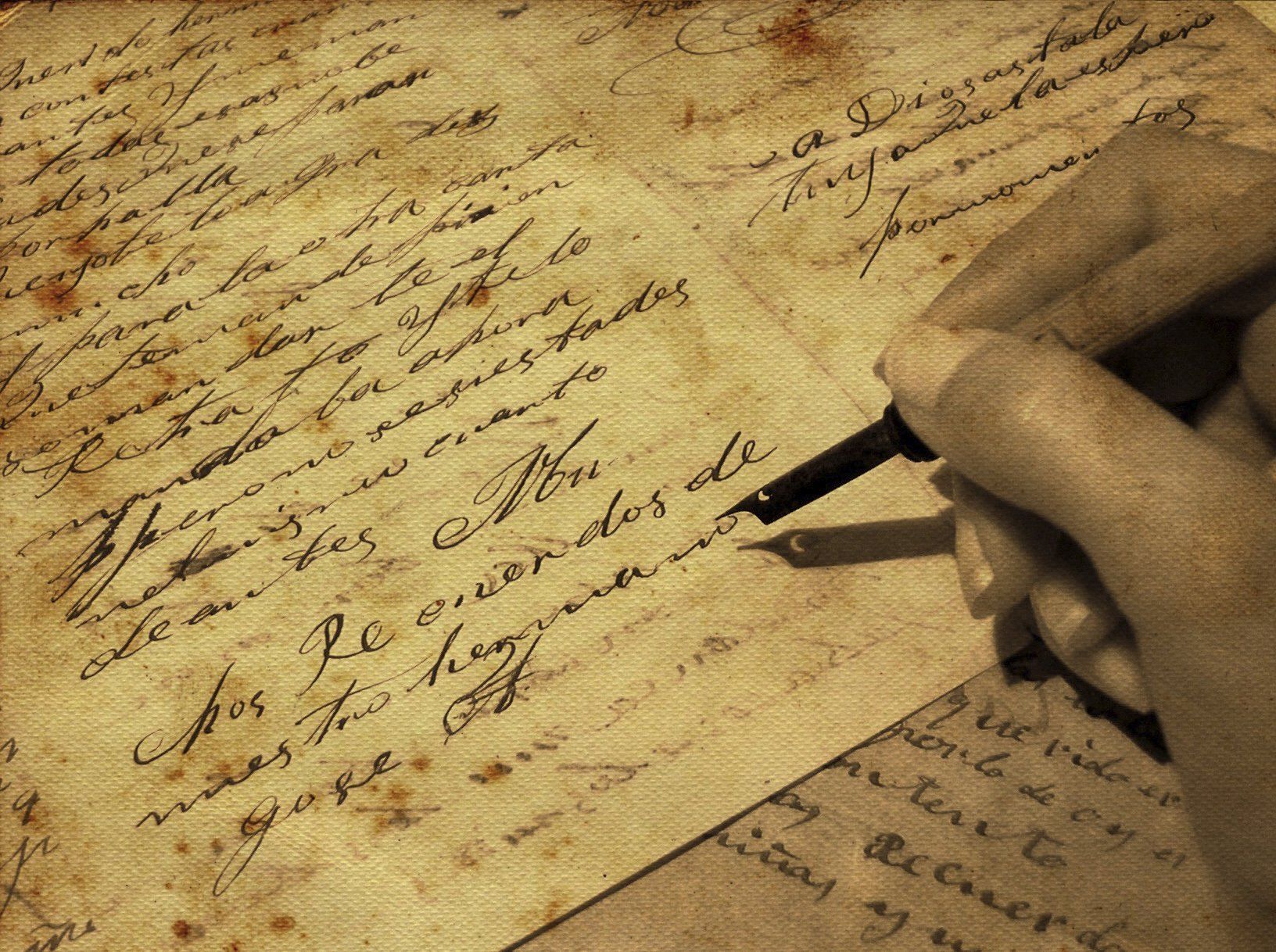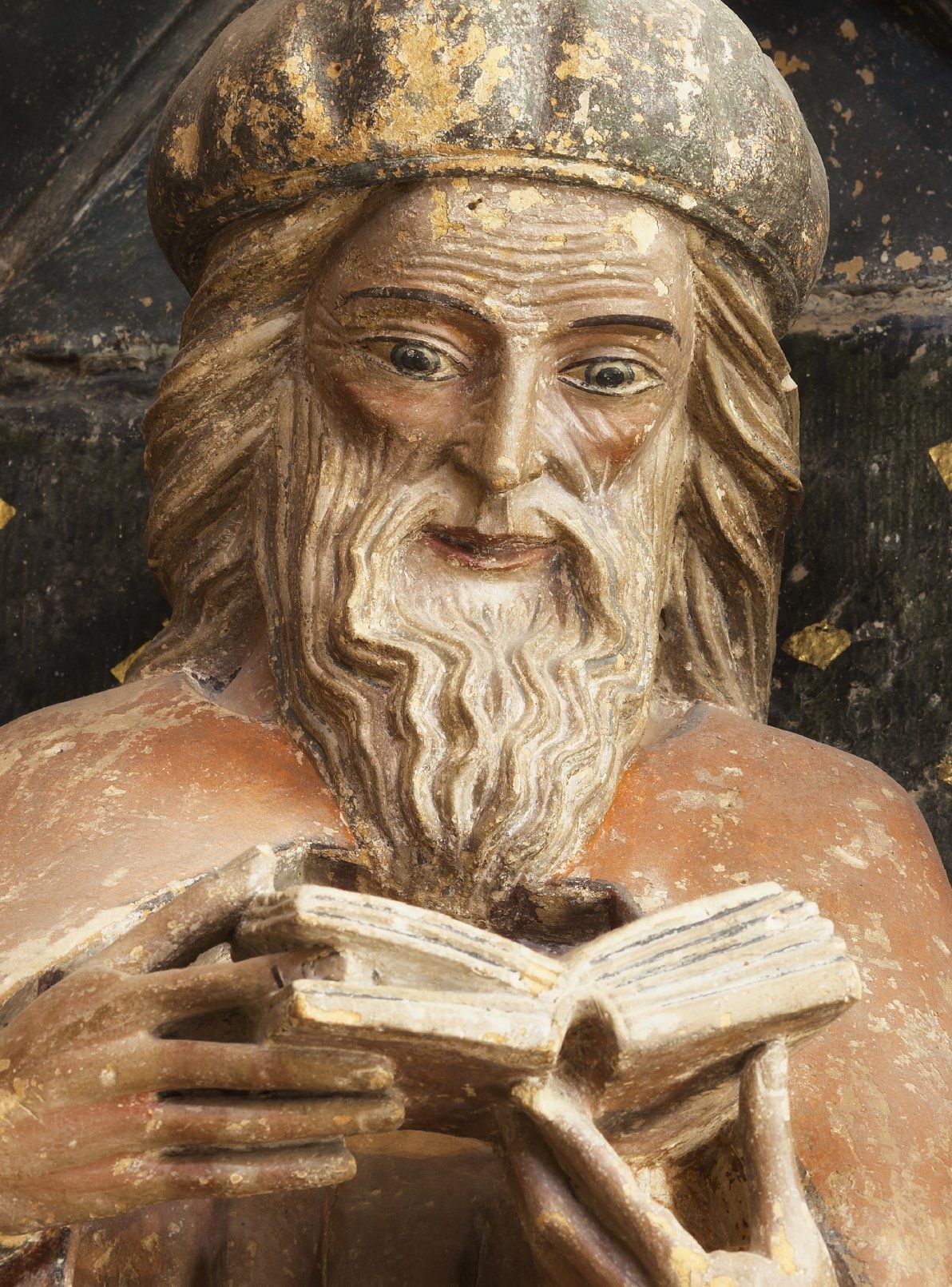von Oliver Weber
•
23. Oktober 2025
Die moralische Pflicht nach juristischem Schluss Es gibt Themen, bei denen man sofort spürt, dass es um mehr geht als um Begriffe. Es geht um Haltung, um Verantwortung und um hier geht es um eine zentrale Frage: Wann endet Schuld? Verjährung ist einer dieser Begriffe. Ein juristisches Wort, das sachlich und nüchtern wirkt – und doch von Bedeutung ist. Denn wenn ein Missbrauch verjährt ist, bedeutet das rechtlich nur eines: Die Tat kann strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden. Aber bedeutet das auch, dass sie vergeben ist? Dass die Schuld erloschen ist? Für die Christianer scheint genau das der Fall zu sein. In ihren Aussagen, in ihrem Verhalten und vor allem in ihrem Schweigen wird eines deutlich: Verjährung wird dort wie ein Schlussstrich behandelt. Als wäre damit alles erledigt. Als gäbe es nichts mehr zu klären. Doch genau das ist ein fataler Irrtum. Denn Verjährung bedeutet nicht, dass nichts geschehen ist. Sie bedeutet lediglich, dass das Gesetz nicht mehr greift. Die Verantwortung aber bleibt – und sie wird nicht kleiner mit der Zeit. Im Gegenteil: Sie wächst, weil sie zu lange ignoriert wurde. Sie wird mit den Jahren immer größer. Was mich besonders erschüttert, ist der Umgang der Christianer mit dieser Verantwortung. So, als wäre sie mit der Verjährung abgeschlossen – wie ein Befreiungsschlag. Dabei geht es hier nicht um ein juristisches Detail. Es geht um die Frage, wie eine christliche Gemeinschaft mit Schuld umgeht, wenn sie glaubt, dass die Zeit allein sie auflöst. In diesem Kapitel geht es um genau diesen Irrtum: die Gleichsetzung von Verjährung und Unschuld. Und um das Schweigen einer Institution, die eigentlich Klarheit schaffen müsste. Denn die zentrale Frage ist nicht: „Was ist verjährt?“, sondern: „Was ist noch offen?“ Und genau daran entscheidet sich, ob eine Gemeinschaft wirklich christlich handelt – oder ob sie Täter schützt, weil es bequemer ist, als Verantwortung zu übernehmen. Verjährung ist keine Entschuldigung – sie ist ein Prüfstein Genau diesen Unterschied aber lassen die Christianer systematisch verschwimmen. Sie ziehen sich auf das Gesetz zurück und tun so, als sei mit dem Ablauf der Verjährung jede moralische Verpflichtung erledigt. Als könne man das Thema einfach abhaken und so tun, als gäbe es nichts mehr zu sagen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Verjährung ist kein Freispruch. Sie ist kein Beweis von Unschuld. Und sie ist kein legitimer Vorwand, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Sie ist schlicht eine juristische Grenze. Nicht mehr – aber auch nicht weniger. Unser Gesetzgeber hat diese Problematik erkannt und die Verjährungsfristen bei sexuellem Missbrauch inzwischen deutlich erhöht. Würde heutiges Recht auf meinen Fall angewendet, wäre die Tat erst im Jahr 2026 verjährt. Nach heutigem Recht wäre es also längst zu einem Prozess gekommen. Doch damals, als der Missbrauch geschah, galten noch deutlich kürzere Fristen. Und deshalb verjährte die Tat bereits im Jahr 2006. Doch hier geht es nicht um Paragrafen, es geht um Moral. Und gerade eine Gemeinschaft, die sich auf christliche Werte beruft, darf sich an dieser Stelle nicht verstecken. Denn wer christliche Ethik ernst nimmt, weiß: Gerechtigkeit endet nicht dort, wo das Strafrecht endet. Sie beginnt oft genau dort, wo das Gesetz aufhört – dort, wo Haltung gefragt ist, wo Mut gefordert ist, Verantwortung zu übernehmen, auch dann, wenn es unbequem wird. Die Haltung der Christianer, Verjährung als Entlastung darzustellen, ist nicht nur unzureichend – sie ist brandgefährlich. Denn sie vermittelt ein Bild, dass mit dem Verstreichen einer Frist auch die Schuld verschwindet. Dass niemand mehr Rechenschaft ablegen muss. Dass auch die Opfer bitte endlich schweigen und zur Ruhe kommen sollen. Aber so funktioniert Aufarbeitung nicht. Und so entsteht keine Gerechtigkeit. Nicht im Recht – und erst recht nicht im Glauben. Schweigen als Schutzschild – und das gefährliche Signal an Täter Noch fataler wird es, wenn man sich anschaut, was aus dieser Haltung in der Praxis geworden ist. Denn das Schweigen der Christianer, ihr Berufen auf Verjährung, ist nicht neutral. Es ist ein Signal, das sich an die Täter richtet: Du musst nur lange genug warten – und du wirst verschont. Du musst nichts bekennen. Du musst nichts aufarbeiten. Du darfst bleiben – genau wie du bist. In meinem Fall ist der Täter bis heute Teil der Gemeinschaft. Er wurde nie zur Rechenschaft gezogen, nie öffentlich benannt. Er unterliegt keinerlei Einschränkungen. Und er hat sich zu keinem Zeitpunkt um Wiedergutmachung bemüht für den Schaden, den er angerichtet hat. Trotz allem, was bekannt war – trotz aller Hinweise und bekannten Fakten. Und es bleibt nicht bei diesem einen Fall. Denn wer einen Täter duldet, ohne klar Stellung zu beziehen, schafft Strukturen, in denen auch andere Täter geschützt werden. Auf dem zentralen Konferenzgelände der Christianer gibt es beispielsweise einen Bereich, in dem bewusst nicht gefilmt wird. Ein Ort, an dem sich nicht nur, aber auch Täter unbeobachtet bewegen können. Und genau dort dürfen sie sich aufhalten – unter dem Vorwand, sie vor öffentlicher Aufmerksamkeit schützen zu wollen. Doch wer braucht hier eigentlich Schutz? Die Täter – oder die Opfer? Und vor allem: Wer garantiert, dass es bei diesem einen Fall bleibt oder geblieben ist? Die Erfahrungen der letzten Jahre sprechen eine andere Sprache. Christliche Werte beginnen dort, wo das Gesetz längst aufgehört hat Die Christianer bezeichnen sich selbst als christliche Gemeinschaft. Sie sprechen von Vergebung, von Nächstenliebe, von Demut. Doch all diese Begriffe verlieren ihren Wert, wenn sie nicht von echter Verantwortung begleitet werden. Vergebung ist kein Automatismus. Sie braucht Reue. Sie braucht einen offenen Umgang mit Schuld. Und sie braucht Konsequenzen. Ein Täter, der sich auf Verjährung beruft, zeigt keine Reue. Er sucht keinen Dialog. Er übernimmt keine Verantwortung. Und diejenigen, die ihn darin unterstützen, handeln nicht christlich, sondern fahrlässig und unverantwortlich. Eine Gemeinschaft, die einem solchen Täter dennoch Rückhalt gibt, stellt sich nicht auf die Seite des Evangeliums – sondern auf die Seite der Gleichgültigkeit. Hier stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit einer ganzen Gemeinschaft. Und ich muss mich, wie schon so oft, wiederholen: Wer sich auf christliche Werte beruft, aber keine Verantwortung übernimmt, verrät genau das, was er vorgibt, zu verteidigen. Wenn man Verantwortung ernst nehmt, dann steht man dazu. Verjährung mag juristisch gelten. Aber moralisch bleibt die Verantwortung bestehen. Wenn man es ernst meint mit Aufarbeitung, dann benennt man Versäumnisse. Klar, öffentlich und unmissverständlich. Es reicht nicht, zu sagen: „Wir bedauern, was geschehen ist.“ Bedauern ersetzt keine Verantwortung. Wer Verantwortung übernimmt, tut das nicht mit Andeutungen – sondern mit Konsequenz. Wenn ihr Täter nicht schützt, dann handelt jetzt Ein überführter Täter, der sich auf Verjährung beruft, zeigt keine Reue. Er übernimmt keine Verantwortung. Und wer ihn dennoch gewähren lässt, stellt den Schutz der Täter über den Schutz der Opfer. Dann gibt man Tätern keine Bühne, keine Rückzugsräume und keine stille Duldung. Dann benennt man sie, bezieht Position und schützt endlich die Richtigen. Wer auf biblischer Grundlage handelt, der nimmt sie ernst Die Bibel ist an dieser Stelle eindeutig: „Nehmt nicht teil an den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf.“ (Epheser 5,11) Das ist keine Bitte. Es ist ein Auftrag. Und Jesaja warnt: „Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis.“ (Jesaja 5,20) Was ist das für ein Verständnis von Vergebung, bei dem der Täter bleiben darf und das Opfer gehen muss? Was ist das für eine Theologie, in der Schweigen als Tugend gilt und das Reden über Unrecht als Verfehlung? Wenn man diese Verse kennt und dennoch schweigt, dann stellt sich eine ehrliche Frage: Was ist aus der eigenen Ethik geworden? Ein Geistlicher stellt sich der Wahrheit Ich weiß, was hinter den Kulissen geschieht. Ich weiß, dass das Reden über Missbrauch und über Verantwortliche als unangemessene Nachrede abgewertet wird. Dass Menschen, die Entscheidungen der Leitung hinterfragen, als illoyal oder gefährlich gelten. Ich weiß, dass sich viele Leitungspersonen als „von Gott gesetzt“ verstehen – und deshalb jede Kritik abwehren, als wäre sie ein Angriff auf Gott selbst. Doch wer so denkt, hat geistliche Leitung mit Machtanspruch verwechselt. In Wahrheit ist genau dieses Verhalten nicht geistlich, sondern sehr menschlich – und schon gar nicht biblisch. Denn wer das Reden über erlittenes Leid zur Sünde erklärt und das Schweigen über Täter zur Tugend erhebt, hat den Kern des Evangeliums nicht verstanden. Ein Geist, der Unrecht deckt, ist nicht heilig. Er ist nicht „von Gott gesetzt“. Er ist bequem und er ist zutiefst antichristlich. Wer auf der Seite der Wahrheit steht, bezieht Stellung Wer auf der Seite der Wahrheit steht, muss das zeigen. Nicht durch Imagepflege und nicht durch juristische Argumente, sondern durch eine Haltung. Und hier ist Schweigen ein Schuldeingeständnis. Ich weiß, dass viele, die dies lesen, mit sich ringen. Aber ich will eines ganz klar sagen: Jeder, der sich zu einer Gemeinschaft bekennt und das bestehende Verhalten einer Leitung akzeptiert, verkörpert damit auch ihr Narrativ. Jeder, der nicht hinterfragt, stellt sich hinter das System – und wird damit, ob er es will oder nicht, Teil der Verdrehung. Und jeder, der die Handlungsweise der Christianer unterstützt oder schweigend mitträgt, unterstützt eine Institution, die nicht christlich handelt, sondern christliche Werte mit Füßen tritt. Das ist nicht nur traurig. Es ist – in seiner Wirkung – gegen christliche Werte. Denn es verrät genau das, wofür der Glaube eigentlich steht: Wahrheit, Gerechtigkeit und Schutz der Schwachen. Und genau deshalb wenden sich heute so viele Menschen zu Recht von christlichen Gemeinschaften ab. Nicht, weil sie mit Glauben nichts anfangen könnten, sondern weil sie erleben, wie dieser Glaube im Namen der Institution verraten wird. Die Gemeinschaft der Christianer reiht sich damit ein unter all jene Kirchen und Bewegungen, deren Schweigen lauter ist als ihr Bekenntnis u nd zerstört damit nicht nur Vertrauen – sondern auch Hoffnung. Und für viele: ihren Glauben.