Update - November 2025
Oliver Weber • 10. November 2025
Update - November 2025

Seit der Veröffentlichung sind nun fast zwei Jahre vergangen. In dieser Zeit ist viel geschehen. Es ist herzerwärmend, mit wie vielen Menschen ich über diesen Kanal in Kontakt treten durfte. Doch je mehr ich mitbekomme, desto klarer wird: Die Geschichten und Muster gleichen sich – und sie zeigen, wie tief das Thema sexueller Missbrauch und der falsche Umgang damit in unserer Gesellschaft verwurzelt ist.
Oft werde ich gefragt, was ich heute mache und wie es weiterging. Persönlich tue ich im Grunde nur das, was jeder Mensch tun sollte: auf die eigene Gesundheit achten und achtsam mit sich selbst und anderen umgehen. Gleichzeitig ist dieser Neubeginn auf seine Weise auch spannend – und doch herausfordernd, mit den Konsequenzen und der neuen Realität umzugehen.
Was die Freikirche betrifft, werde ich kurz auf die aktuelle Sachlage eingehen – ohne zu sehr ins Detail zu gehen.
Infobox: Buch "Die schuldigen Hirten" von Thomas Großbölting, Herder Verlag
Aktuelle Sachlage
Weder hat die Glaubensgemeinschaft den Namen des Täters innerhalb ihrer Gemeinschaft bis heute bekannt gemacht, noch hat sich der Täter öffentlich oder persönlich zu der Tat bekannt. Damit kann er sich weiterhin unerkannt und unbehelligt im Umfeld der Mitglieder bewegen, und das tut er auch.
Eine Überprüfung, ob es im Zuge seiner jahrelangen Tätigkeit als Trainer in einem Turnverein weitere Übergriffe oder gar Missbrauch gab, die er über all die Jahre in Kenntnis der Gemeindeleitung ausübte, wurde damit faktisch unterbunden. Die Glaubensgemeinschaft stützt sich auch heute noch, entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse, auf eine sogenannte Therapie, in der dem Täter wohl bescheinigt wurde, „dass weitere pädophile Übergriffe nicht wahrscheinlicher seien, als bei der Durchschnittsbevölkerung“. Diese Einschätzung ist bis heute zentraler Bestandteil der internen Kommunikation über den Täter.
Auf dieser Grundlage wurde, ohne uns in irgendeiner Weise einzubeziehen, diese „Vereinbarung“ getroffen, die den Besuch gemeinsamer Veranstaltungen im Verhältnis 50:50 regeln sollte – also: halb der Täter, halb wir als die Betroffenen. Selbstverständlich stünden uns auch die restliche Zeit uneingeschränkt zur Verfügung, jedoch halt im Beisein des Täters. Die Einschränkungen dieser Vereinbarung wurden inzwischen vollständig aufgehoben.
Ein einfacher Gemeindewechsel des Täters wurde kategorisch abgelehnt – trotz der Tatsache, dass eine nahegelegene Lokalgemeinde in weniger als 30 Minuten erreichbar wäre. Begründet wurde dies seitens der Gemeindeleitung über ihren Anwalt mit der Aussage, das sei nicht so einfach – obwohl die Anfahrtswege anderer Gemeindemitglieder teilweise weitaus länger sind.
Der Täter bewegt sich bis heute in unmittelbarer Nähe zu Opfern sexuellen Missbrauchs, Kindern und Jugendlichen, obwohl der Gemeindeleitung diese Tatsache bekannt ist. Ein Ausschluss des Täters oder sonstige Einschränkungen wurden vom obersten Kinderschutzbeauftragten der Gesamtorganisation mit der Begründung abgelehnt, Vergebung mache dies „nicht möglich“. Laut Angaben ihres Anwalts besteht dennoch eine Auflage darin, dass der Täter bei regionalen oder überregionalen Gemeindeveranstaltungen in einem Bereich sitzen muss, der nicht gefilmt werden darf, damit er in internen Streams oder sonstigen Übertragungen nicht zu sehen ist.
Obwohl die Gemeinschaft auf ihrer Website eine umfangreiche Präventionsstrategie mit Null Toleranz Anspruch und überregionaler Schutzstruktur darlegt, zeigt die Realität ein anderes Bild: Es werden weiterhin aktuelle Bilder veröffentlicht, auf denen der Täter gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen zu abgebildet ist.
Doch wenn der oberste Kinderschutzbeauftragte der Organisation, der die Prävention verantwortet, zugleich derjenige ist, der einem ihm bekannten Täter sexuellen Missbrauchs, dessen Tat zu diesem Zeitpunkt noch nicht verjährt war, die Teilnahme an Seminaren über Kinderschutz und Prävention erlaubt hat, darf man die Glaubwürdigkeit und fachliche Kompetenz dieser Funktion ernsthaft in Frage stellen.
Der Täter ist auch auf Social Media weiterhin aktiv und gut vernetzt. Sein Profil weist über 700 Follower auf, die überwiegend aus dem Umfeld der Gemeinschaft stammen; er selbst folgt mehr als 2000 Personen. Die Zahl seiner Beiträge ist im vergangenen Jahr sogar leicht gestiegen.
Bis zum letzten Jahr befanden sich unter seinen Followern auch Jugendliche und minderjährige Jungen und Mädchen. Auf einzelnen Beiträgen waren zudem Kinder zu sehen, die mir äußerlich als Kind ähnlich sahen. Da sich die Zahlen seiner Follower und Beiträge seither kaum verändert haben, ist anzunehmen, dass sich auch an den Inhalten und Kontakten im Wesentlichen nichts geändert hat, und das obwohl er bereits Bilder von seinem Account löschen musste, auf denen ich und meine Kinder zu sehen waren. Wie sich in diesem Beispiel von Akzeptanz und bewusstem Gewährenlassen eine Null-Toleranz-Grenze oder gar eine funktionierende Schutzstruktur erkennen lassen soll, bleibt wohl ihr Geheimnis.
Unter der Hand ist der Täter bekannt. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie sich Gemeindemitglieder wissentlich mit einem Missbrauchstäter verbinden und wie Eltern von Kindern und Jugendlichen dieses Verhalten weder unterbinden noch hinterfragen, sondern stillschweigend akzeptieren. Ebenso unverständlich ist, dass diese Eltern es akzeptabel finden, dass die Gemeindeleitung seit fast dreißig Jahren den Täter wissentlich in unmittelbaren Kontakt zu Kindern und Jugendlichen ließ. Bis heute steht sie uneingeschränkt der Gemeinde vor und ist weiterhin mit dem Täter freundschaftlich verbunden. Das ist ein bedrückendes Beispiel dafür, warum sexueller Missbrauch in unserer Gesellschaft so ungestört und tief verwurzelt fortbesteht.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass von Vergebung gesprochen wird, der Täter die Tat jedoch nicht von sich aus offenbarte, sondern von mir überführt werden musste. Zudem hat er zu keinem Zeitpunkt – weder damals noch heute – von sich aus auf Nähe zu Kindern und Jugendlichen verzichtet oder auch nur den Versuch einer Wiedergutmachung unternommen.
Wie man zu einer derart kreativen Auslegung des theologischen Begriffs Vergebung gelangt, wenn der Täter bis heute nicht einmal zu seiner Tat steht, übersteigt mein Verständnis.
Wir sind als Familie dem Rat von Fachleuten gefolgt und haben die Gemeinschaft aufgrund der Art und Weise, wie sie mit dem Missbrauch, dem Täter und der Aufarbeitung umgegangen ist und bis heute umgeht, vollständig und kompromisslos verlassen.
Erschreckend ist, dass es in der Gemeinschaft nicht nur Ärzte, (Kinder-)Krankenschwestern, Lehrer und Menschen aus sozialen Berufen gibt, sondern auch Tagesmütter, Erzieherinnen sowie Personen mit hohen Bildungsabschlüssen in leitenden Positionen oder Unternehmensführungen, die dies wissend und stillschweigend akzeptieren.
Und ich bezweifle, dass jemand, der in dieser Frage stillhält oder wegschaut, in anderen Situationen, in denen es um den Schutz von Kindern geht, tatsächlich verantwortungsvoll handeln würde.
Nach allem, was ich inzwischen über interne Abläufe und den teils haarsträubenden Umgang mit Konfliktsituationen erfahren habe, der teils auch mit demselben Personenkreis der Leitung zu tun hat und darüber hinaus andere Bereiche betrifft, distanziere ich mich heute eindeutig von dieser Organisation.
Infobox: Reportage "Mensch und nicht Monster" BR, Wie Franz Wuth verantwortungsvoll mit seiner Pädophilie umgeht.
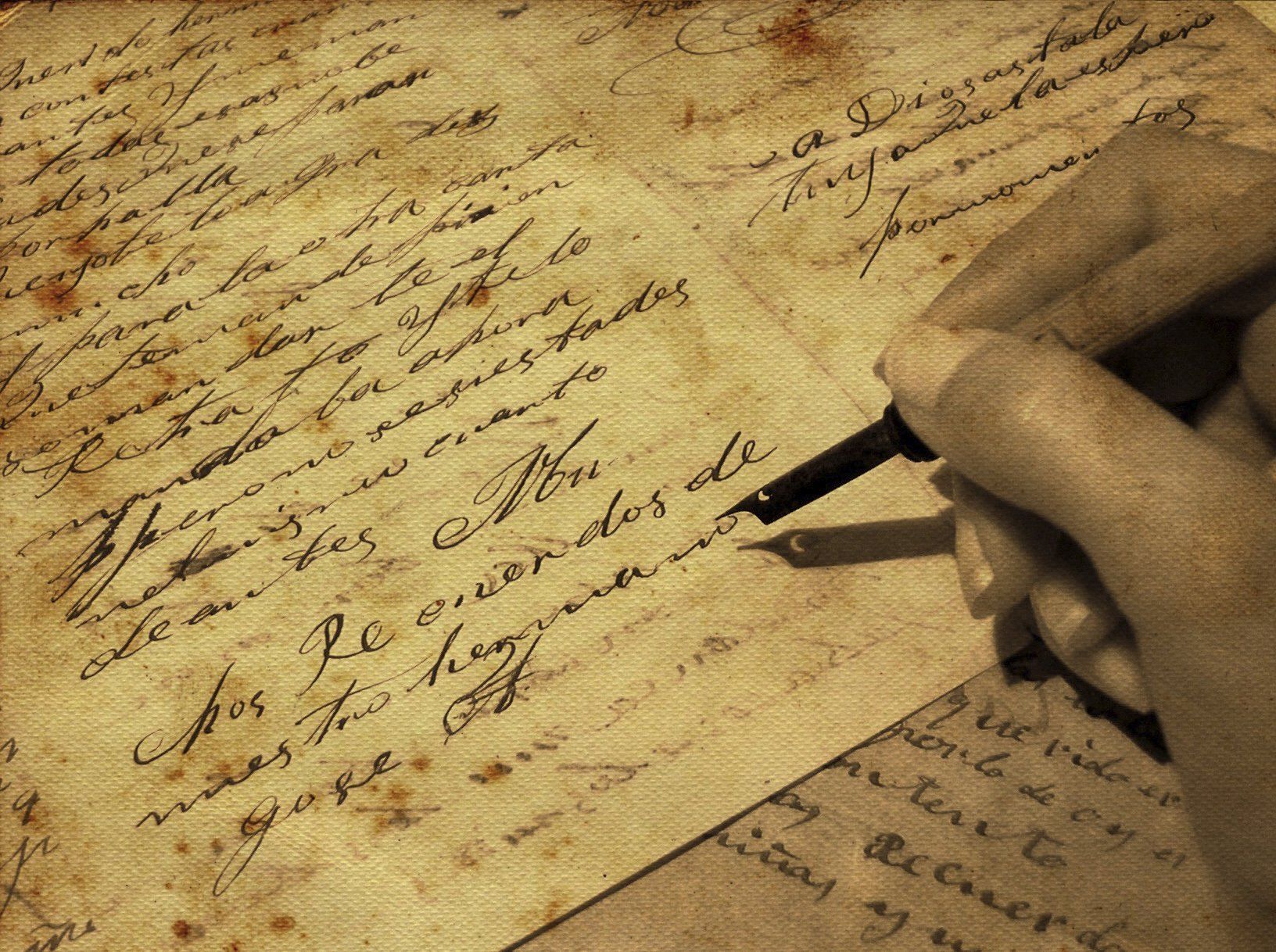
Lieber Ober-Christian, ich schreibe dir, weil sich ein paar Fragen stellen. Nur eines vorweg: Dein Advokat war, so empfinde ich es zumindest, etwas pampig. Vielleicht täusche ich mich, aber das war mein Eindruck. Was ich jedoch nicht verstehe, ist seine Aussage, ich bräuchte ebenfalls einen Advokaten, um dir zu schreiben. Das Problem ist nur: Ich habe gar keinen, der ein Mandat in Verbindung mit dir hätte – ich habe lediglich einen, der mich gegenüber dem Täter vertritt. Oder fühlst du dich dem Täter so stark verbunden? Ich brauche eigentlich keinen. Ich bin erwachsen, kann sehr gut selbst für mich reden und brauche niemanden, hinter dem ich mich verstecken müsste. Auf alle Fälle müsste ich mir erst einen suchen – was ich gerne für dich tun kann. Ich finde nur, dass es dafür Geld auszugeben unnötig ist. Wenn du das wünschst, lege ich dem Schreiben die Rechnung bei, die du dann bitte begleichen solltest. Dann können wir gerne so verfahren. Sag mir einfach Bescheid. Ganz prominent habe ich auf meiner "Home"-Seite ein Bild einer roten Lampe für dich gesetzt. „Täter an Bord“ steht dort. Ich werde dir kurz erklären, was es damit auf sich hat. Vor vielen Jahren war ich beruflich öfter in unserer Landeshauptstadt in den Kommandozentralen der amerikanischen Kasernen. Und immer, wenn ich dort im Hochsicherheitsbereich war, hatte ich zum einen einen persönlichen Bodyguard an meiner Seite und zum anderen wurde ein Schalter betätigt, der in jedem Raum des Sicherheitsbereichs eine rote Lampe aktivierte. Diese rote Lampe bedeutete, dass sich jemand dort aufhielt, der dort normalerweise nichts zu suchen hatte. Und genau so eine rote Lampe habe ich dir jetzt auch installiert. Denn solange ein Täter unbenannt und unerkannt in deiner Arche sein kann, wird diese Lampe leuchten. „Täter an Bord.“ Du meinst, Einschränkungen gegen den Täter verböten sich. Ich sehe das grundlegend anders. Ein Täter sollte nirgends unerkannt und unbenannt in der Nähe von Kindern und Jugendlichen sein. Also nie. Und deshalb wird diese rote Lampe so lange leuchten, bis du den Täter in deiner Gemeinde offiziell benennst. Denn auch in der Nähe anderer Betroffener hat er einfach nichts zu suchen. Ebenso sollten Menschen, die euch besuchen, wissen, dass Vorsicht geboten ist. Und Kinder sollten geschützt werden. Da sind wir hoffentlich einer Meinung. Aus der Bibel liegt dir der Satz besonders am Herzen: „Wer dem Geringen Gewalt tut, spottet dessen Schöpfer.“ Damit wurdest du nicht müde zu mahnen. „Ich werde einen Missbrauchstäter selbst vor das Gerichtsgebäude tragen“, hast du einmal lauthals verkündet. „Gut gebrüllt, Löwe“, wäre mir fast rausgerutscht – ich kleiner Schlingel. Es hat seine eigene Tragik, wenn als Wahrheit gedachte Bücher sich im Nachhinein als Märchen entpuppen. Dann schreibe ich lieber Märchen, die wahr sind. Eines wie dieses zum Beispiel: „Die Parabel vom lieben Wolf.“ Ich weiß jetzt nicht, wo du dich gerade aufhältst. In deiner Villa in Übersee oder vielleicht im Hubschrauber auf dem Weg zu einem wichtigen Termin. Du bist ja immer noch ein viel beschäftigter Mann. Ich habe mal versucht, etwas über dein materielles Vermögen ausfindig zu machen. Habe dich fast nicht gefunden und immer unten in der Tabelle. Bis ich herausgefunden habe, dass ich echt tollpatschig war. Ich hatte sie schlicht falsch herum gehalten. Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, in der du von einem Zitat eines Berichtes gesprochen hast, das Eindruck auf dich gemacht hatte: „Du kannst die Welt nicht retten, wenn du kein Geld hast.“ Da muss ich dir recht geben. Ich kann es nicht. Durch meine Auszeit ist ein Schaden entstanden, über den du wahrscheinlich nur müde lächeln kannst und das kann ich dir nicht verdenken. Bei mir wird das mit dem Weltretten jedenfalls erstmal nichts, zumindest nicht finanziell. Aber mit dir zusammen vielleicht. Wenn wir gemeinsam die Welt retten. Du mit dem Geld und ich mit den Ideen. (Keine Sorge, das ist nur ironisch gemeint.) Vielleicht erinnerst du dich noch an die Gala, die du weltweit in den Äther geschickt hast, als wir auf der Bühne gemeinsam eine Reise mit den Kindern veranstaltet haben. Als wir in Europa mit dem Bus losgefahren sind, dann in Afrika getrommelt haben, nach Asien und sogar nach Australien hat es uns verschlagen, um dann noch über den Amazonas nach Amerika zu kommen. Es war ein schöner Moment, das gebe ich zu – als ich dann an das Lied „Glückskinder“ gedacht habe, hab ich mich fast verschluckt. Und jetzt kommt der kleine Scherz, den du mir bitte nicht übel nimmst: Kurzum, ein wenig Startkapital für unsere Kinderschutzprojekte würde wirklich helfen. Wir haben einiges vor. Falls du also einmal zwischen Villa und Hubschrauber über das Thema stolperst – fühl dich nicht verpflichtet, aber du weißt, wo du uns findest. Dann noch ein sehr ernst gemeintes Thema. Deine Gefolgschaft verbreitet gerne das Bild vom Einzelfall. Du liebst doch Herausforderungen genauso wie ich. Nehmen wir also spaßeshalber mal an, das sei tatsächlich so – dann dürfte doch folgende Wette keine wirkliche Herausforderung sein: Wie wäre es damit - d u wettest Geld auf mich als Einzelfall. Sagen wir eine Million. Ob Euro oder Dollar kannst du ja nach Kontinent entscheiden. Die tun dir nicht weh und wie man dies steueroptimiert ausweist, dafür hast du ja deine Experten. Doch dieses Geld wird ja auch erst fällig, wenn ich dir oder deinen Unter-Christianen nachweisen kann, dass ihr es zugelassen habt, dass sich ein Täter in mittelbarer und unmittelbarer Nähe eines Opfers sexueller Gewalt befindet oder befunden hat – und denen zahlst du es dann aus. Eine faire sportliche Wette, oder was meinst du? Und zum Schluss habe noch eine konkrete Frage. Sicher kennst du den Begriff „Einrede der Verjährung“. Das ist dieser kleine juristische Trick, mit dem man sagen kann: „Ja, etwas mag passiert sein, oder ich mag eine Straftat begangen haben – aber heute möchte ich bitte nicht mehr darüber sprechen, weil die Sache verjährt ist.“ Juristisch völlig in Ordnung, moralisch aber eher… nennen wir es großzügig. Und da hätte ich eine Frage an dich, lieber Ober-Christian. Ganz unabhängig von meinem Fall, also rein theoretisch: Wie stehst du dazu aus deiner christlichen Sichtweise? Findest du, dass man die Einrede der Verjährung bei einer Straftat ruhig nutzen sollte, wenn sie gerade gut passt? Oder würdest du eher sagen, dass man sich als Christ – der ja gerne von Wahrheit, Verantwortung und Demut spricht – vielleicht nicht unbedingt hinter einer abgelaufenen Frist verstecken sollte? Deine Haltung dazu, also dafür oder dagegen, würde mich wirklich interessieren. Aber jetzt genug der Worte. Ich werde dir von nun an gelegentlich schreiben. Vielleicht entwickelt sich ja tatsächlich eine kleine Brieffreundschaft. Bleib gesund und immer frisch voran! Dein Olli PS: Halte dir doch einmal den 1. Juli oder den 20. September nächstes Jahr frei. Da haben wir Weltkindertag. Vielleicht sieht man sich ja auf einer Veranstaltung – ich würde sogar ein Namensschild für dich bereithalten, damit du weißt, wo dein Platz ist. Aber keine Sorge: Wenn du lieber unerkannt bleiben möchtest, richten wir selbstverständlich einen Bereich ein, der nicht gefilmt wird.

Es war ein idyllischer Ort hoch oben in den Bergen. Klare Bäche schlängelten sich durch die grünen und saftigen Bergwiesen. Dort lebten ein paar Hirten friedlich mit ihrer Herde. Eines Tages stand ein besonderes Tier am Rand ihrer Herde. Es sah aus wie ein Schaf, hatte auch ein weiches Fell und den gleichen treuherzigen Blick wie die anderen Schafe. Nur seine Schnauze und sein Schwanz erinnerten an einen Wolf. Auch wenn man es nicht sofort erkannte: es war ein Wolf.

„Es wurde bereits genug unternommen.“ So lautet eine weitere Schutzbehauptung – und sie vermittelt auf den ersten Blick beinahe den Eindruck, als habe man sich tatsächlich bemüht, als seien Maßnahmen erfolgt, die eine gewisse Haltung erkennen ließen. Doch wie tragfähig diese Selbstdarstellung ist, zeigt sich erst bei genauerem Hinsehen. Zu Beginn zwei Passagen aus der offiziellen Kommentierung der Gemeindeleitung. Dort heißt es, der damalige Jugend-Christian habe nach meiner Meldung im Jahr 2000 den obersten Kinderschutz-Christian informiert. Man betont, es seien bestimmte Einschränkungen vorgenommen worden: Der Täter habe nicht mehr an überregionalen Veranstaltungen teilgenommen und auch innerhalb der Gemeinde nicht mehr dieselben Aufgaben ausgeübt wie früher. In einer weiteren Darstellung wird hervorgehoben, der Täter habe fortan keine Rollen mit „sichtbarem Charakter“ übernommen und sei eher im Hintergrund geblieben. Diese Hinweise sollen verdeutlichen, dass man reagiert und damit konsequent gehandelt habe. Doch die Frage ist, welche Bedeutung diese Maßnahmen tatsächlich hatten. Betrachtet man sie genauer, erkennt man, dass sie kaum über symbolische Gesten hinausgingen. Der Täter blieb weiterhin Teil der Gemeinschaft, er nahm weiterhin an Veranstaltungen teil, und er bewegte sich weiterhin in einem Umfeld, in dem auch Kinder anwesend waren. Es gab keine transparente Information an die Gemeinde, keine Einordnung, keine offizielle Klärung dessen, was geschehen war. Niemand wurde gewarnt, niemand konnte einschätzen, welche Risiken bestanden. Die Maßnahmen führten also nicht zu einer tatsächlichen Distanzierung, sondern lediglich zu einer geringeren Sichtbarkeit, ohne dass die reale Gefahr in irgendeiner Weise reduziert worden wäre. In diesem Zusammenhang taucht auch die Behauptung auf, ein Umzug sei von mir nicht gewünscht gewesen. Damit wird suggeriert, ich hätte die entscheidende Konsequenz verhindert. Doch ein solcher Hinweis verschiebt die Frage nach verantwortlichem Handeln auf das Opfer – und übersieht dabei vollständig, dass ein Umzug das Problem nicht gelöst hätte. Der Täter wäre lediglich in einer anderen Ortsgemeinde aufgetaucht, wo niemand gewusst hätte, was er getan hatte. Dort hätte er erneut Vertrauen gewinnen und erneut Zugang zu Kindern erhalten können. Auch das wäre keine konsequente Maßnahme gewesen, sondern lediglich ein Ortswechsel ohne Schutzwirkung. Wenn es der Gemeinschaft damals wirklich um Sicherheit gegangen wäre, hätten andere Schritte notwendig und angemessen gewesen: eine klare Information innerhalb der Gemeinde, eine eindeutige Distanzierung vom Täter, die Einbindung externer Fachstellen und eine transparente Aufarbeitung des Geschehens. All dies wäre möglich gewesen, doch nichts davon wurde umgesetzt. Stattdessen entschied man sich für Maßnahmen, die möglichst wenig veränderten und dennoch den Eindruck erwecken sollten, es sei gehandelt worden. Vor diesem Hintergrund gewinnt ein Satz aus dem Matthäus-Evangelium besondere Bedeutung: „Ihr siebt Mücken aus und verschluckt Kamele.“ (Matthäus 23,24) Genau das lässt sich hier beobachten. Man konzentrierte sich auf Randbereiche, die äußerlich nach Ordnung wirkten, während die zentrale Aufgabe – ein wirksamer Schutz und eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Geschehen – unbeachtet blieb. So entstand kein Schutzraum, sondern ein Schweigeraum. Das eigentliche Problem war nicht, dass zu wenig getan wurde, sondern dass bewusst zu wenig getan wurde. Gerade so viel, dass man den Anschein von Aktivität erzeugen konnte, ohne wirklich Konsequenzen zu ziehen. Die Schutzbehauptung „Es wurde bereits genug unternommen“ beschreibt daher keine Realität, sondern eine Strategie. Und deshalb stelle ich die einfache, aber entscheidende Frage: Wenn tatsächlich genug unternommen wurde – warum blieb der Täter dann über all die Jahre Teil der Gemeinde? Warum wusste niemand Bescheid? Warum wurde niemand gewarnt? Und wem haben diese Maßnahmen letztlich gedient? Belastungstest Schutzbehauptung Nr. 7 „Es wurde bereits genug unternommen.“ Was ist die Behauptung? Es habe konkrete Schritte gegeben, die als angemessene Reaktion auf den Missbrauch bewertet werden könnten. Was soll sie aussagen? Dass die Leitung ihrer Verantwortung nachgekommen sei und jede weitere Forderung nach Aufklärung überzogen sei. Was ist die Intention dahinter? Durch punktuelle Einschränkungen den Eindruck entstehen zu lassen, man habe entschlossen gehandelt – obwohl die wesentlichen Maßnahmen bewusst unterlassen wurden. Glaubt ihr das wirklich selbst? Wenn ihr ehrlich seid, wohl kaum. Wer nur dort Maßnahmen ergreift, wo sie das eigene System nicht belasten, zeigt keinen Schutzwillen, sondern ein taktisches Interesse an Ruhe und Fassade. Analyse: Der Kern des Problems lag nicht in dem, was getan wurde, sondern in dem, was man vermeiden wollte: eine tatsächliche Auseinandersetzung mit einem Täter in der eigenen Mitte und die Verantwortung, die daraus entstanden wäre. Jetzt mal ehrlich: Wer wirklich schützen und aufarbeiten will, versteckt sich nicht hinter Maßnahmen, die beruhigen sollen, ohne etwas zu verändern. Wer es ernst meint, hält Täter nicht im vertrauten Umfeld – sondern sorgt dafür, dass niemand erneut in Gefahr gerät.

„Wir konnten nichts tun, weil der Missbrauch im privaten Rahmen stattfand.“ Beginnen wir wieder mit zwei Zitate aus unterschiedlichen Schreiben des Christian-Advokat. Zitat 1: In dem Schreiben steht, eine Anzeige sei aus heutiger Sicht nicht mehr sinnvoll. Begründet wird dies damit, dass der Missbrauchsvorgang bereits Jahrzehnte zurücklag, außerhalb des Gemeindekontexts im privaten Rahmen stattgefunden habe und der betreffende Mann kein offizielles Amt innerhalb der Christianer ausgeübt habe. Zitat 2: Hier lautet es sinngemäß identisch: Die Gemeinschaft habe keine Möglichkeit gehabt einzugreifen, da sich der Missbrauch außerhalb des Gemeindekontexts ereignet habe und damit als private Angelegenheit galt. Es gibt Schutzbehauptungen, die besonders sorgfältig formuliert wirken. Sie klingen juristisch glatt, rechtlich unauffällig, aber sind moralisch ausweichend. Richtig ist, dass heute eine Anzeige wegen der Verjährung nicht mehr sinnvoll wäre. So weit, so richtig. Aber relevant sind jedoch diese Aussagen: „Der Missbrauch fand im privaten Rahmen statt.“ „Der Täter hatte nie ein Amt innerhalb der Gemeinde.“ Was heißt das genau? Heißt das, Missbrauch wird nur dann relevant, wenn er auf einem Gemeindefest passiert? Oder wenn der Täter ein offizielles Amt trägt? Aber sobald jemand regelmäßig dabei ist, Jugendliche begleitet und Vertrauen genießt, soll das kein Problem mehr sein? Diese Argumentation ist nicht nur absurd, sie ist gefährlich. Sie trennt die Tat künstlich von der Struktur, die sie hätte stoppen oder zumindest eindämmen können. Folgt man dieser Logik, bedeutet das: Solange etwas nicht auf dem Gemeindegelände geschieht, geht es die Gemeinschaft nichts an. Und solange der Täter kein offizielles Amt hat, fühlt sich niemand verpflichtet einzugreifen. Dazu kommt, dass es in den Freikirchen meist überhaupt keine offiziellen Ämter gibt – sondern lose organisierte Zuständigkeiten. Dann ist es besonders leicht zu sagen, er habe kein Amt gehabt. Aber wie nennt man die Helfertätigkeiten bei Kinderspielaktivitäten? Formal sind sie keine Ämter – praktisch sind sie trotzdem ein direkter Zugang zu Kindern. Und g enau dort beginnt systemisches Versagen. Denn Missbrauch ist kein privates Thema. Er wird nicht harmloser, nur weil er räumlich woanders passiert. Missbrauch ist immer ein Verbrechen. Und die eigentliche Frage lautet nicht: „Wo ist es passiert?“ sondern: „Wie wurde damit umgegangen, als man davon wusste?“ Und wenn man dann hört, dass dieser Mann zwar kein Amt innerhalb der Christianer hatte, aber als Trainer in einem Sportverein tätig war, dann frage ich mich: Ist das kein Auftrag? Ist das kein Vertrauensverhältnis? Oder zählt es einfach nicht, weil es formal außerhalb der Gemeinschaft stattfand? Eines steht zumindest fest: Die Christianer wussten Bescheid. Sie wussten, was geschehen war. Spätestens seit dem Jahr 2000 war der Missbrauch gemeldet – zu einem Zeitpunkt, an dem die Tat noch nicht verjährt war. Und die Wahrheit ist: Nicht das Gesetz hat den Täter geschützt – sondern die Christianer selbst. Und v iele Jahre später, als das Thema diesmal offen angesprochen wird, beginnt man sich auf juristische Details zu berufen: „Privater Rahmen.“ „Kein Amt.“ „Verjährung.“ Aber niemand stellte die entscheidende Frage: Warum war der Täter trotzdem willkommen? Denn das war er. Er war Teil der Gemeinde. Er nahm an Veranstaltungen teil. Er war bei Jugendaktivitäten dabei. Er wurde nicht zur Rechenschaft gezogen. Er wurde nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil: Er wurde verteidigt und geschützt. Kein Elternteil wurde gewarnt und niemand wurde informiert. Man nahm in Kauf, dass es nicht bei einem Opfer bleibt und man nahm in Kauf, dass es längst weitere Opfer geben könnte. Es ging also nie um die formale Frage, ob jemand ein Amt hat. Es ging immer darum, wie man mit dem eigenen Wissen umgeht. Und wenn man heute sagt: „Wir konnten nichts tun, es war ja privat“, dann ist das keine Erklärung. Es ist ein Freispruch in eigener Sache – ein Versuch, Untätigkeit schön zu verpacken. Auch hier ist die Bibel eindeutig: „Habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie auf.“ (Epheser 5,11) Missbrauch wird genau dann zu einem systemischen Problem, wenn eine Gemeinschaft davon erfährt und ihn dann geheim hält. Und deshalb stelle ich wieder die Frage: Wenn es wirklich am privaten Rahmen lag, und wenn es angeblich keine Rolle spielte, dass der Täter kein Amt hatte – warum blieb er trotzdem Teil der Gemeinde? Warum wurde er nicht ausgeschlossen? Warum wurde niemand gewarnt? Und wem nützt es, wenn man sich hinter juristischen Formeln versteckt, die man angeblich gar nicht gekannt hat, weil man sich angeblich nie informiert habe? Belastungstest Schutzbehauptung Nr. 6 „Der Missbrauch war privat, der Täter hatte kein Amt.“ Was ist die Behauptung? Die Christianer hätten nicht eingreifen können, weil die Tat außerhalb ihres Bereichs lag und der Täter keine offizielle Funktion hatte. Was soll sie aussagen? Dass jede Grundlage für Maßnahmen gefehlt habe. Was ist die Intention dahinter? Man versucht, das eigene Nichtstun als fehlende Zuständigkeit erscheinen zu lassen – und sich so jeder Erwartung zu entziehen. Glaubt ihr das wirklich selbst? Wenn ihr ehrlich seid, nein. Wer weiß, was geschehen ist, und den Täter dennoch willkommen heißt, schützt keine Gemeinschaft – sondern Strukturen, die Täter begünstigen. Analyse: • Die Tat wird künstlich von der Gemeinschaft getrennt, als sei sie nur relevant, wenn sie vor Ort passiert. • Der eigentliche Skandal wird verdeckt: Man wusste es – und hat geschwiegen. • Statt Schutz wurde Deckung für den Täter gewährt. • Der notwendige Schritt wurde bewusst vermieden. Jetzt mal ehrlich: Wenn ihr wusstet, was dieser Mann getan hat und ihn dennoch in eurer Mitte duldetet, dann ist nicht der private Rahmen das Problem.

„Wir waren nicht ausgebildet.“ Dann sehen wir uns nun eine weitere Schutzbehauptung genauer an. Zu Beginn zwei Passagen aus dem offiziellen Schreiben des Christian-Advokat. In einem seiner Schreiben steht sinngemäß: N ach offizieller Darstellung habe es unter den Beteiligten keinerlei Ausbildung oder Erfahrung im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs gegeben – was man hier erstaunlicherweise als „Extremsituation“ bezeichnet. Oder an einer anderen Stelle: Nach offizieller Darstellung habe es innerhalb der Christianer zu jener Zeit keinerlei klare Richtlinien oder Vorgaben zum Umgang mit sexuellem Missbrauch gegeben. Man betont, dass auch die Mitglieder der Gemeindeleitungen weder geschult noch im Umgang mit solchen Fällen vorbereitet gewesen seien. Die Schutzbehauptung lautet also: „Wir waren nicht ausgebildet.“ Das klingt auf den ersten Blick beinahe verständlich – ein wenig überfordert, ein wenig unbeholfen. Fast so, als hätte man ja handeln wollen, aber nicht gewusst, wie. Und immerhin – so scheint es – nicht böswillig. Doch genau das macht diese Schutzbehauptung so gefährlich. Denn sie erklärt das eigene Versagen, ohne es eingestehen zu müssen. Stattdessen wird die Verantwortung verschoben – weg von den handelnden Personen, hin zu etwas Abstraktem: zu Strukturen, zu Systemen, zu „fehlenden Leitplanken“. Aber so einfach ist es nicht. Denn wer sich auf mangelnde Schulung beruft, muss sich die Frage gefallen lassen: Was habt ihr mit dem Wissen getan, das ihr hattet? Und: Warum habt ihr euch nicht darum bemüht, das zu lernen, was ihr gebraucht hättet? Denn fest steht: Man wusste Bescheid. Und zwar nicht irgendwo – sondern ganz oben. Schon in den frühen 2000er-Jahren war das Thema sexueller Missbrauch innerhalb der Christianer präsent. Nicht nur in kleinen Kreisen, sondern in der Leitung selbst. Der damalige Kinderschutz-Christian der internationalen Dachorganisation reiste damals durch die Gemeinden, sprach über sexualisierte Gewalt, über Prävention und über Verantwortung auf überregionalen Veranstaltungen. Und heute heißt es: „Wir waren nicht ausgebildet.“ „Wir wussten nicht, was zu tun ist.“ Ich empfinde das, bei allem Respekt, als grotesk. Denn wenn man sich mit dem Thema bereits befasst hat, stellt sich eine andere Frage: Warum hat niemand in diesem konkreten Fall gehandelt? Warum hat man einen Kinderschutz-Christian benannt, wenn niemand wusste, was seine Aufgabe ist? Und wenn der oberste Kinderschutz-Christian tatsächlich keine Fachkenntnis hatte – obwohl er über das Thema referierte und wusste, dass ein Täter in der eigenen Organisation war, sogar an seinen eigenen Vorträgen teilnahm – warum hat er sich dann keine Hilfe geholt? Warum hat er nicht gesagt: „Das übersteigt unsere Kompetenz – wir brauchen Profis.“ Denn genau das wäre möglich gewesen. Auch damals schon gab es Jugendämter, Beratungsstellen und Fachleute. Dann wird oft angeführt, dass das Thema damals nicht so präsent war. Das ist richtig, aber sie haben noch nicht einmal das Jugendamt kontaktiert. Und auch damals gab es schon ein Strafrecht. Also ich weiß nicht... Man hätte sich Hilfe holen können – innerhalb weniger Tage. Aber man hat es aus diversen Gründen bewusst nicht getan. Und dann stellt sich zwangsläufig die Frage: Wem hat das genutzt? Dem Schutz der Kinder, d em Schutz des Betroffenen, o der dem Schutz des Täters – oder vielleicht dem Schutz der eigenen Organisation? Denn das ist der entscheidende Punkt: Nicht-Wissen ist keine Entschuldigung. In dem Moment, in dem man weiß, dass ein Missbrauch stattgefunden hat, beginnt Verantwortung. Nicht erst, wenn ein Handbuch auf dem Tisch liegt. Nicht erst nach der ersten Schulung. Sondern in dem Moment, in dem man weiß, dass ein Kind verletzt wurde – und der Täter bekannt ist. Wir reden hier nicht von einem Verdacht auf Missbrauch. Da wäre Zurückhaltung vielleicht erklärbar gewesen. Aber hier handelt es sich um ausgeübten Missbrauch. Da wussten sie schon im Mittelalter, dass dies nicht gesellschaftlich tragfähig ist. Da lohnt sich ein Blick in die Bibel, auf die sie sich ja fundamental berufen. Im Buch Micha heißt es: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist – und was der HERR von dir fordert: nichts als Recht tun, Güte lieben und demütig sein vor deinem Gott.“ (Micha 6,8) Da steht nichts von Schulungsstand, nichts von Protokollen, sondern d a steht: Recht tun, Güte leben und Verantwortung übernehmen. Wer wirklich Gutes tun will, braucht kein perfektes Konzept. Man muss nur hinschauen und handeln. Doch genau das ist hier nicht geschehen. Denn in Wahrheit ging es nicht darum ob man geschult war. E s ging darum, ob man handeln wollte. Und man wollte eben nicht. Man wollte gar nicht wissen, wie man mit Missbrauch umgehen sollte – weil man dann hätte handeln müssen. Und so bleibt am Ende eine einfache Wahrheit: Diese Schutzbehauptung – „Wir wussten nicht, was zu tun ist“ – ist keine Entschuldigung. Sie ist eine bequeme Ausrede. Sie schützt nicht die Kinder, sie schützt Strukturen. Und sie soll diejenigen schützen, die bis heute nicht bereit sind, sich ihrer Verantwortung zu stellen. Und diese Verantwortung bedeutet, dass sie einen Täter kannten – ihn aber nicht von der Gemeinde ferngehalten haben. Das ist die Verantwortung, von der wir sprechen. Und deshalb stelle ich am Ende diese eine Frage: Wenn es also stimmt, dass sie angeblich nicht geschult oder ausgebildet waren – und wenn das wirklich der Grund war, nichts zu tun – dann stellt sich eine ganz andere Frage: Warum hat dennoch niemand Verantwortung übernommen? Warum hat man sich nicht helfen lassen? Und wer profitiert am meisten, wenn man sich als hilflos und unwissend darstellt – während Kinder ungeschützt bleiben? Belastungstest Schutzbehauptung Nr. 4 „Wir waren nicht ausgebildet.“ Was ist die Behauptung? Die Leitung sei im Umgang mit sexuellem Missbrauch weder geschult noch beruflich erfahren gewesen. Was soll sie aussagen? Dass etwaige Fehlentscheidungen nicht auf bösen Willen, sondern auf Überforderung oder Unwissenheit zurückzuführen seien. Was ist die Intention dahinter? Die Verantwortlichen wollen ihr Nichthandeln entdramatisieren und sich selbst entlasten, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Glaubt ihr das wirklich selbst? Wenn ihr ehrlich seid – nein. Denn wer einen Kinderschutz-Christian einsetzt und Vorträge über Missbrauch hält, der hat Wissen. Er hat nur nicht gehandelt. Analyse: • Die Aussage wirkt demütig, ist aber eine strategische Vernebelung. • Verantwortung wird von Personen auf Strukturen verschoben – als wäre man Opfer der Umstände. • Es wird der Eindruck vermittelt, man habe „nicht anders gekonnt“, obwohl man sich aktiv gegen Hilfe entschied. • Das angebliche Unwissen schützte nicht die Betroffenen, sondern das System. Jetzt mal ehrlich: Diese Schutzbehauptung ist keine Erklärung, s ie ist ein Ablenkungsmanöver. Denn in Wahrheit hat man es bewusst und mit voller Absicht unterlassen, sich etwa beim Jugendamt zu melden.

„Die Verantwortlichen hatten nur begrenzte Informationen und haben sich rausgehalten.“ Diese Aussage taucht in unterschiedlichen Varianten in internen Schreiben und Gesprächen der Christianer auf – immer mit demselben Effekt. Sie soll erklären, warum niemand gehandelt hat, und gleichzeitig Verantwortung verschieben. In einem anwaltlichen Schreiben hieß es sinngemäß, ein leitender Verantwortlicher sei nur grob über einen Missbrauchsfall informiert worden. Er habe zunächst nicht gewusst, wer betroffen oder wer der Täter war, habe lediglich erfahren, dass etwas vorgefallen sei, und sich deshalb aus der Sache herausgehalten. Auf den ersten Blick wirkt das nüchtern, fast technisch, wie ein Verwaltungsvermerk. Doch auch hier lohnt sich ein genauer Blick. Solche Formulierungen wollen nicht nur erklären – sie wollen entlasten, ohne dass jemand Verantwortung übernimmt. Sie erzeugen Sätze wie: „Die Verantwortlichen wussten nicht genug.“ „Einige wurden gar nicht über Details informiert.“ „Manche waren nicht beratend einbezogen.“ Konkret heißt das: Ein Gemeinde-Christian, der über Jahre hinweg Verantwortung trug und zugleich familiär mit dem damaligen Gemeinde-Christian verbunden war, will angeblich nicht gewusst haben, dass es in seiner eigenen Gemeinde einen bekannten Missbrauchsfall gab. Er habe nicht gewusst, wer betroffen war, nicht, wer der Täter war. Und weil man ihm keine Details genannt habe, habe er sich auch nicht eingemischt. Ganz ehrlich: Wie glaubwürdig ist das? In einer Gemeinschaft, die sich selbst als geistlich besonders nah und vertrauensvoll versteht, in der regelmäßig über Erziehungsfragen, Ehen und familiäre Konflikte gesprochen wird, soll beim Thema sexueller Missbrauch niemand etwas gewusst oder gefragt haben? Für mich ist das schwer vorstellbar. Wer die Strukturen kennt, weiß: Solche Informationen verschwinden nicht zufällig. Sie werden nicht vergessen, sondern sie werden verwaltet. Und selbst wenn man der Darstellung glaubt, dass bestimmte Personen nichts wussten, bleibt die entscheidende Frage: Warum hat niemand nachgefragt? Warum hat niemand gesagt: „Was genau ist da passiert?“ „Wer ist betroffen?“ „Was muss ich wissen, um Verantwortung zu übernehmen?“ Wer Verantwortung trägt und schweigt, obwohl er es besser wissen müsste, macht sich mitschuldig. Und wer sich bewusst raushält, obwohl es um den Schutz von Kindern geht, handelt nicht nur fahrlässig, sondern verantwortungslos. Damals wandte ich mich erneut an den damaligen Gemeinde-Christian, weil ich mit der Reaktion nach meiner ersten Offenbarung des Missbrauchs nicht einverstanden war, und erzählte ihm meine Geschichte. Dieses Gespräch blieb mir sehr negativ in Erinnerung. Ich bat ihn ausdrücklich um Diskretion – nicht, um etwas zu vertuschen, sondern weil ich wusste, wie schnell in dieser Struktur Gerüchte entstehen. Ich wollte die Folgen abmildern – für mich, aber auch für die Gemeinschaft. Einige Zeit später fiel mir beim heutigen Gemeinde-Christian eine auffällige Reaktion auf, und ich fragte direkt nach: „Hast du es Christian-X erzählt?“ Er verneinte nicht, sondern sagte: „Ich werde dir keine Rechenschaft darüber geben, was ich mit wem rede.“ Diese Antwort sagte in ihrer Ausweichung mehr, als ein klares Nein jemals hätte sagen können. Wenn man nichts zu verbergen hat, warum sagt man es dann nicht einfach? Und d amit sind wir beim Kern. Es geht nicht darum, wer wann welches Detail wusste. Es geht darum, ob jemand gehandelt hat oder nicht. Und genau deshalb ist diese Schutzbehauptung so perfide, weil sie das Bild vermittelt: „Ich war verantwortlich, aber eben nicht zuständig.“ Ein Satz, der vielleicht in einer Behörde passt, aber nicht in einer Glaubensgemeinschaft, die sich auf christliche Werte beruft. Von den Rednerpulten wird oft von Verantwortung, Mitleid und geistlicher Anteilnahme gesprochen. Man bringt Bibelstellen wie: „Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit.“ (1. Korinther 12,26) „Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich’s nicht vernichten müsste; aber ich fand keinen.“ (Hesekiel 22,30) Aber in meinem Fall? Da war kein Mitleiden, und da stellte sich niemand in den Riss. Als es darauf ankam, als Schutz nötig gewesen wäre, ist man pietätlos von der Mauer gefallen. Und wenn man heute sagt: „Wir wussten nicht genug“, dann frage ich: Für welches Handeln hätten die Informationen denn gereicht? Es gibt Situationen, in denen Menschen sich durch ihr Verhalten für künftige Verantwortung disqualifizieren. Und das hier ist so ein Fall. Wenn also das stimmt, was in den internen Schreiben steht – und das sind ihre eigenen Worte –, dann müsste man über Disqualifikation sprechen. Doch in dieser Gemeinschaft wagt kaum jemand, das offen zu sagen, weil Hörigkeit Verantwortung ersetzt. Und falls jemand meint, ich würde diese Aussagen falsch wiedergeben, muss ich an die Christianer verweisen. Sie geben sicher gern Einsicht in die entsprechenden Schriftstücke. Belastungstest Schutzbehauptung Nr. 2 „Die Verantwortlichen hatten nur begrenzte Informationen und haben sich rausgehalten.“ Was ist die Behauptung? Führende Personen hätten nur eingeschränkt Informationen erhalten und deshalb keine aktive Rolle übernommen. Was soll sie aussagen? Dass sie sich korrekt verhalten hätten, indem sie sich zurückhielten, weil ihnen die Details fehlten. Was ist die Intention dahinter? Nachträgliche Entlastung durch gezieltes Vorenthalten von Informationen. Verantwortung soll minimiert oder abgelehnt werden, obwohl sie faktisch bestand. Glaubt ihr das wirklich selbst? Wenn ihr ehrlich seid, wohl kaum. Denn wer sich als geistliche Leitung versteht, fragt nach und schützt. Wer sich raushält, schützt nicht – er schweigt sich schuldig. Analyse: • Die Aussage dient der Reputationssicherung, nicht der Aufklärung. • Sie ersetzt Verantwortung durch die Behauptung von Unwissen. • Wer nichts wissen will, weil er nicht handeln will, trägt trotzdem Verantwortung. • Die Gemeinde schwieg und ließ das Opfer allein. Jetzt mal ehrlich: Wenn ihr angeblich nicht wusstet, was zu tun ist, warum habt ihr nicht gefragt? Warum habt ihr euch rausgehalten, statt einzustehen? Und: Zumindest der oberste Kinderschutz-Christian wusste doch Bescheid …?

„Er hat selbst darum gebeten, dass nichts unternommen wird.“ Diese Aussage taucht in verschiedenen Varianten in Schreiben, Protokollen und Gesprächen innerhalb der Christianer auf – immer mit derselben Wirkung: Sie verschiebt die Verantwortung – von der Institution auf das Opfer. Bereits in einem internen Schreiben der Christianer, in dem über den „Vorfall“ berichtet wurde, hieß es sinngemäß, ich hätte dem damaligen Jugend-Christian anvertraut, was geschehen war – und zugleich darum gebeten, dass er mit niemandem darüber spricht. Auch seine Frau habe angeblich versprechen müssen, über die Sache zu schweigen. In einem späteren anwaltlichen Schreiben wurde dann zusammengefasst, dass der Täter nie ein offizielles Amt innerhalb der Gemeinschaft gehabt habe und es „aus heutiger Sicht“ nicht mehr angebracht sei, den Fall anzuzeigen – angeblich, weil ich selbst das nicht gewollt hätte. Und auch in einem Kommentar der lokalen Leitung wurde betont, mir sei es besonders wichtig gewesen, dass der heutige Vize-Gemeinde-Christian mit niemand über den Missbrauch spricht. Zudem wurde dort angeführt, ich hätte nicht gewollt, dass der Täter und seine Frau die Gemeinde verlassen. Die Aussage lautet also: Ich selbst hätte darum gebeten, dass nichts unternommen wird. Echt jetzt? Glaubt ihr das echt selbst? Denn: Nach außen klingt das beinahe fürsorglich. Als hätte man meinen Wunsch respektiert und Rücksicht genommen. Doch in Wahrheit ist dieser Satz ein rhetorischer Trick, der das eigene Nichthandeln legitimieren soll. Und was damit passiert, ist bemerkenswert: Die Perspektive verschiebt sich: Nicht mehr der Täter steht im Zentrum. Nicht mehr die Leitung, die nichts unternahm, sondern ich als Opfer. Denn plötzlich lautet die Frage nicht mehr: „Warum habt ihr nicht gehandelt?“ Sondern: „Hast du damals wirklich alles richtig gemacht?“ Deshalb sage ich heute ganz klar: Diese Aussage ist definitiv falsch. Ich habe nie darum gebeten, dass nichts unternommen wird. Was ich gesagt habe, war sehr bewusst: Ich wollte nicht, dass meine Geschichte unkontrolliert unter den Christianern verbreitet wird. Ich wollte keine Gerüchte, keine Unwahrheiten und kein Flüstern im Gemeindeflur. Ich wollte, dass mit dieser Information sensibel, vertraulich und verantwortungsvoll umgegangen wird. Denn schon damals war klar: Die Leitung hatte nicht den Ruf, persönliche Informationen diskret zu behandeln. Diese Bitte war ein Schutz für mich, nicht für den Täter. Es war nie ein „Bitte macht nichts“ – sondern ein: „Bitte geht damit sorgfältig um.“ Daraus wurde jedoch im Nachhinein ein Freibrief für Untätigkeit gemacht. Heute heißt es: „Wir hätten ja gehandelt – aber er wollte nicht, dass wir etwas tun.“ Und so erklärt sie sich selbst frei – während der Täter über Jahre hinweg Teil der Gemeinschaft blieb – ohne Konsequenzen. Dabei bin ich damals jeden Schritt gegangen, den man auch innerhalb der Christianer als die „richtige Vorgehensweise“ bezeichnet hätte: Ich habe mich an den Jugend-Christian gewandt, dann an den Gemeinde-Christian. Ich bin nach Frankreich gefahren, um mit dem Deutschland-Christian zu sprechen. Die Information ging weiter an den obersten Kinderschutz-Christian. Ich habe es öfters gesagt und habe es benannt. Und ich habe darauf vertraut, dass sie das Richtige tun. Doch allein, dass ich die Hierarchiestufen durchlaufen habe, galt offenbar schon als illoyal. Dies wurde damals als Verrat gedeutet – als dreiste Majestätsbeleidigung. Aber ich bin niemandem „in den Rücken gefallen“. Ich bin ihnen nur entgegengetreten, weil sie nicht gehandelt haben – obwohl sie es gekonnt hätten. Und sie wussten, was zu tun gewesen wäre. Wenn ich heute an diese Situation zurückdenke, fällt mir eine Szene aus einem Kinderhörspiel ein, die das Verhalten der Verantwortlichen ziemlich genau trifft: Vielleicht kennt ihr noch „Benjamin Blümchen als Feuerwehrmann“. Ein Feuer bricht aus, der Alarm schrillt und einer der Feuerwehrmänner ruft panisch: „Holt doch mal einer die Feuerwehr!“ Und Benjamin sagt: „Aber… wir sind doch die Feuerwehr!“ Genauso war es hier. Ich habe das Feuer gemeldet, ich habe den Alarm ausgelöst. Und sie? Sie haben sich umgeschaut und gefragt: „Wer ist denn jetzt zuständig?“ Dabei war klar: Sie selbst waren es. Es gab niemand anderen. Und sie entschieden sich – aus welchen Gründen auch immer – dazu, zu schweigen. Das wirklich Perfide daran ist: Heute tun sie so, als hätten sie handeln wollen – aber ich (das Opfer) hätte es ihnen untersagt. Das ist keine bloße Verdrehung. Das ist eine gezielte, infame Umkehrung der Tatsachen. Denn ganz gleich, was ich damals gesagt oder nicht gesagt habe – es spielte keine Rolle. Das war belanglos. Wenn eine Organisation weiß, dass ein Täter, der sexuelle Gewalt an einem Kind ausgeübt hat, Teil ihrer Gemeinschaft ist – wenn sie weiß, dass dieser Mensch Kontakt zu Kindern hatte und wieder haben könnte – dann braucht sie keine Erlaubnis vom Opfer. Dann braucht es nur eines: Verantwortung. Und gerade die Christianer, die sich als geistlich besonders tief verankert sehen und sich fundamental auf die Bibel berufen – sie müssten es besser wissen. Denn sie kennen auch diese Worte Jesu: „Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Ärgernis wird, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er in der Tiefe des Meeres versenkt würde.“ (Matthäus 18,6) Das ist keine symbolische Floskel. Das ist eine scharfe, unmissverständliche Warnung – an alle, die Kinder gefährden. Und an alle, die davon wissen – aber nichts tun. Und genau das ist hier geschehen. Nach allem, was bekannt war, hätte man wissen können, was zu tun gewesen wäre. Aber – man hat sich aus bestimmten Gründen entschieden, untätig zu bleiben. Auch dazu findet sich eine klare Aussage in der Bibel: „Wer weiß, was gut ist, und tut es nicht – dem ist es Sünde.“ (Jakobus 4,17) Schweigen ist nicht neutral. Nicht-Handeln ist keine Option. Es ist Schuld. Und es ist Verantwortung – die nicht einfach verschwindet. Noch ein Vers, der in diesem Zusammenhang besonders wichtig ist: „Tu deinen Mund auf für die Stummen, für die Sache derer, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf, richte gerecht, und schaffe Recht dem Elenden und Armen.“ (Sprüche 31,8–9) Diese Worte bekommen ein ganz anderes Gewicht, wenn man wieder bedenkt, dass viele innerhalb der Christianer sich selbst als geistlich überlegen verstehen. Von genau diesen Menschen erwarte ich: Gerechtigkeit. Wenn es also stimmen würde, dass ich gesagt habe, dass nichts unternommen werden soll – und wenn daraus wirklich abgeleitet wurde, dass man über Jahrzehnte den Täter geduldet hat – ihn mit Kindern in Kontakt treten und ihn z. B. als Trainer in einem Sportverein wirken ließ und die Christianer nicht warnte – dann stellt sich eine ganz andere Frage: Wer hat sich hier eigentlich schuldig gemacht? ________________________________________ Belastungstest Schutzbehauptung Nr. 01 „Er hat selbst darum gebeten, dass nichts unternommen wird.“ Was ist die Behauptung? Der Betroffene habe ausdrücklich darum gebeten, dass keinerlei Schritte gegen den Täter eingeleitet werden. Was soll sie aussagen? Dass die Leitung aus Rücksicht auf den Wunsch des Opfers nicht tätig wurde – und damit moralisch korrekt gehandelt habe. Was ist die Intention dahinter? Entlastung der Institution. Die Verantwortung für das eigene Nichthandeln wird dem Opfer zugeschoben – elegant, scheinbar empathisch, aber zutiefst manipulativ. Echt jetzt? Glaubt ihr das wirklich selbst? Wenn ihr ehrlich wärt – nein. Denn wer weiß, dass ein Täter in einer Gemeinde aktiv ist, braucht keine Erlaubnis des Opfers, um zu handeln. Er braucht nur Handeln – und Rückgrat. Analyse: • Die Aussage klingt verständnisvoll, ist aber strategisch platziert. • Die Leitung handelte nicht aus Fürsorge – sondern aus Kalkül. Denn Schweigen bedeutete: kein Skandal, kein Aufwand, kein Gesichtsverlust. • Der Schutz des Täters wog schwerer als der Schutz des Opfers. Jetzt mal ehrlich: Diese Schutzbehauptung ist nicht nur falsch. Sie ist eine bewusste Verdrehung der Realität. Und sie zeigt exemplarisch, wie Sprache eingesetzt wird, um institutionelles Versagen als Opferverantwortung umzudeuten. Kann man machen. Aber was das mit Redlichkeit zu tun hat? Wer weiß…

Worte haben Macht und deshalb sollten wir sie uns genau ansehen: Sie können aufdecken oder verschleiern, s ie können verbinden oder entzweien. Sie können Verantwortung übernehmen oder sie gezielt umgehen. Deshalb lohnt es sich, genau hinzusehen, gerade dann, wenn eine Institution versucht, ihr Handeln zu erklären – oder besser gesagt: es zu rechtfertigen. In den Jahren nach der erneuten Offenlegung meines Missbrauchs wurde ich immer wieder mit Aussagen konfrontiert, die auf den ersten Blick harmlos wirken. Ja, fast freundlich. Sie klingen besonnen, vernünftig, fast schon verständnisvoll. Doch wer genauer hinhört, merkt schnell: Diese Worte verfolgen ein bestimmtes Ziel. Sie sollen das Opfer in Frage stellen – und gleichzeitig die Verantwortung von den Entscheidern ablenken. Sie sollen beruhigen, aber nicht aufklären. Sie sollen Verständnis signalisieren – aber keine Konsequenzen zulassen. Sie tarnen sich als Rücksicht, aber in Wahrheit sind sie Schutzbehauptungen. Sätze wie: „Wir wussten nicht genug.“ „Er wollte doch keine Anzeige.“ „Wir waren überfordert.“ Das sind keine Lügen – aber sie sind eben auch nicht ehrlich. Das sind Sätze, die nicht falsch klingen – aber trotzdem nicht richtig sind. Beim ersten Lesen wirken sie plausibel wirken, aber beim zweiten Mal lösen sie ein diffuses Unbehagen aus. Und genau hier setzt diese Rubrik an. Echt jetzt ? Diese Rubrik soll gezielt den Fluss etwas unterbrechen. Sie ist ein Stoppzeichen und soll ein Moment des Innehaltens sein – und einfach verständlicher Klartext. "Echt jetzt?" ist eine Lupe, die sichtbar macht, was zwischen den Zeilen verborgen liegt. Sie ist eine einfache Offenbarung von Unwahrheiten – entgegen der offiziellen Darstellung. Ein funktionierender Kompass in einem System, das sich selbst rechtfertigt. Denn wenn Worte Macht haben – dann ist diese Rubrik genau ihr Gegengewicht. Klar, einfach und unerbittlich. Echt jetzt? Glaubt ihr das echt selbst?
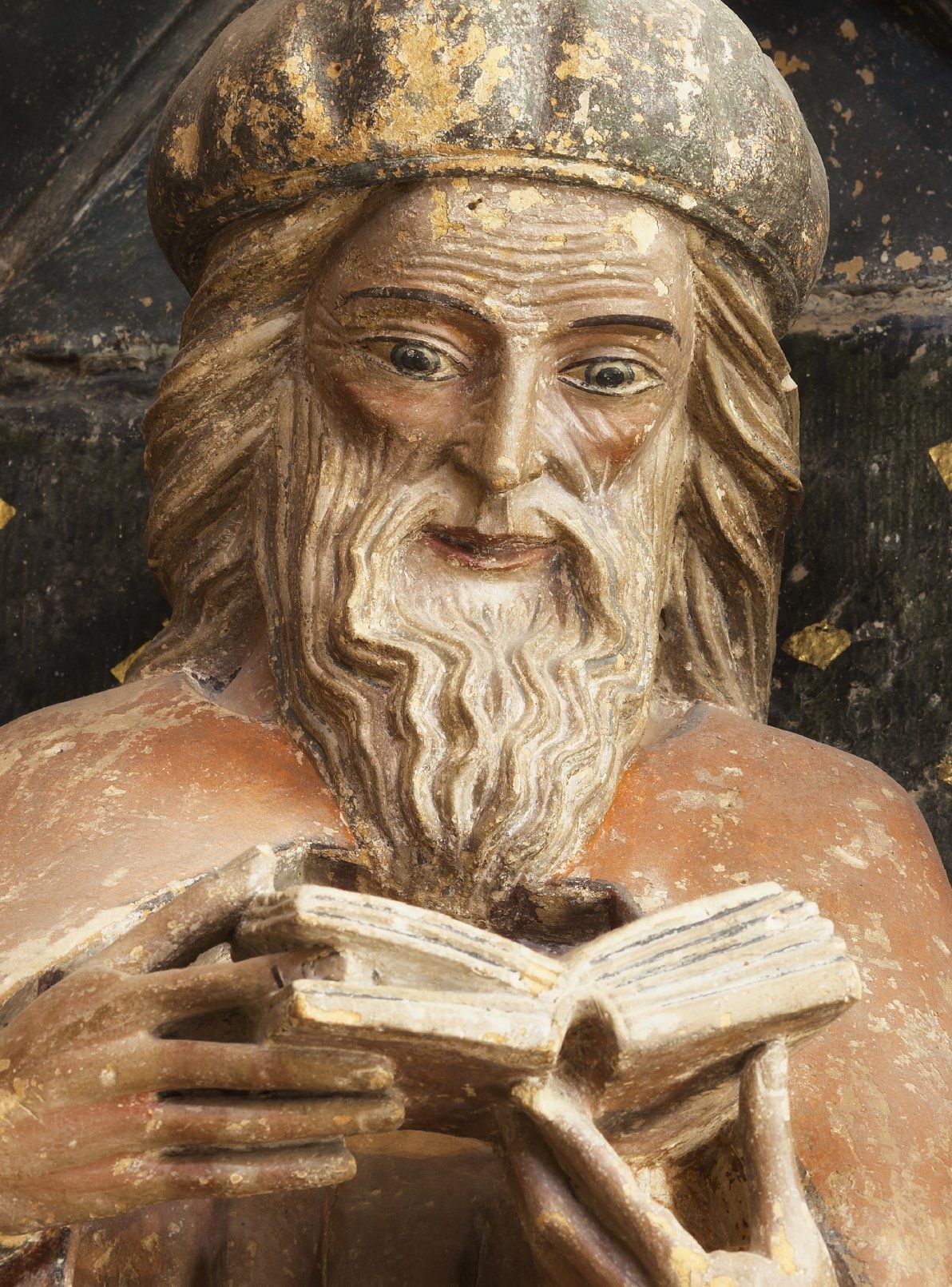
Kollektives Wegsehen An alle, die das hier lesen und denken: „Ja, schlimm. Aber das betrifft uns nicht.“ Ich kann Sie beruhigen. Aber nur, wenn Sie nicht im Umfeld der Christianer leben und keine kleinen Kinder oder Enkelkinder haben. Denn die Realität ist: Auch in Ihrem direkten Umfeld könnten Erzieherinnen, Tagesmütter, Lehrerinnen oder Pflegekräfte arbeiten, die sich den Christianern zugehörig fühlen. Menschen also, die Teil jener Gemeinschaft sind, die einen pädophilen Täter weiterhin akzeptiert – wissend, was er getan hat. Ich hatte von der Leitung gefordert, den Missbrauch an mir öffentlich zu machen. Und tatsächlich: Sie haben meinen Namen als Betroffenen – auf meinen Wunsch hin – genannt, und auch pflichtgemäß bedauert. Doch den Namen des Täters haben sie verschwiegen. Nach außen blieb er anonym. Innerhalb einer solchen Gemeinde jedoch verbreiten sich Informationen sehr schnell und jeder weiß, wer gemeint ist. In dem Artikel über die sogenannte „Vereinbarung“ habe ich beschrieben, wie Täter und Opfer getrennt werden sollten. Diese Regelung existiert heute nicht mehr, weil meine Familie und ich den Christianern nicht mehr angehören und uns klar von ihnen distanzieren. Deshalb bestehen für den Täter keinerlei Einschränkungen mehr. Er bewegt sich wieder völlig frei in der hiesigen Gemeinde und wird angesehen und behandelt wie ein „guter Christenmensch“, den man – aus Gründen der Vergebung – nicht antasten will. Er ist also vollständig rehabilitiert. Und deshalb muss man eine einfache Frage stellen: Was passiert, wenn dieser Mann künftig auf andere Kinder trifft? Auf andere Betroffene? Was geschieht in einer Gemeinschaft, die sein Verhalten kennt – und trotzdem schweigt? Warum Akzeptanz Mittäterschaft ist Ich bezweifle, dass jemand, der einen bekannten pädophilen Täter duldet und hinnimmt, dass er weiter ungehindert in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen kommt, im Ernstfall klar und mutig handeln wird. Wer heute schweigt, wird morgen nicht schützen. Wer hinnimmt, dass ein Täter wieder volle Freiheit hat, wird im nächsten Verdachtsfall kaum plötzlich Rückgrat zeigen. Wenn wir sagen: „Das betrifft uns ja nicht“, schieben wir Verantwortung ab. Und dann passiert, was immer passiert, wenn Menschen schweigen: Unrecht wächst im Verborgenen – bis es irgendwann offen zutage tritt. Die unbequeme Wahrheit Jeder, der diesen Artikel liest, müsste eigentlich beginnen, Fragen zu stellen. Denn hier steht alles deutlich genug, und deshalb nochmals zur Erinnerung: • Eine Gemeinschaft akzeptiert einen bekannten Missbrauchstäter. • Sie schützt ihn, indem sie seinen Namen verschweigt. • Und sie ermöglicht damit, dass er weiterhin mit Kindern und Jugendlichen agiert. Die bittere Erkenntnis ist: Es wird sich nichts ändern, denn es betrifft ja niemand.
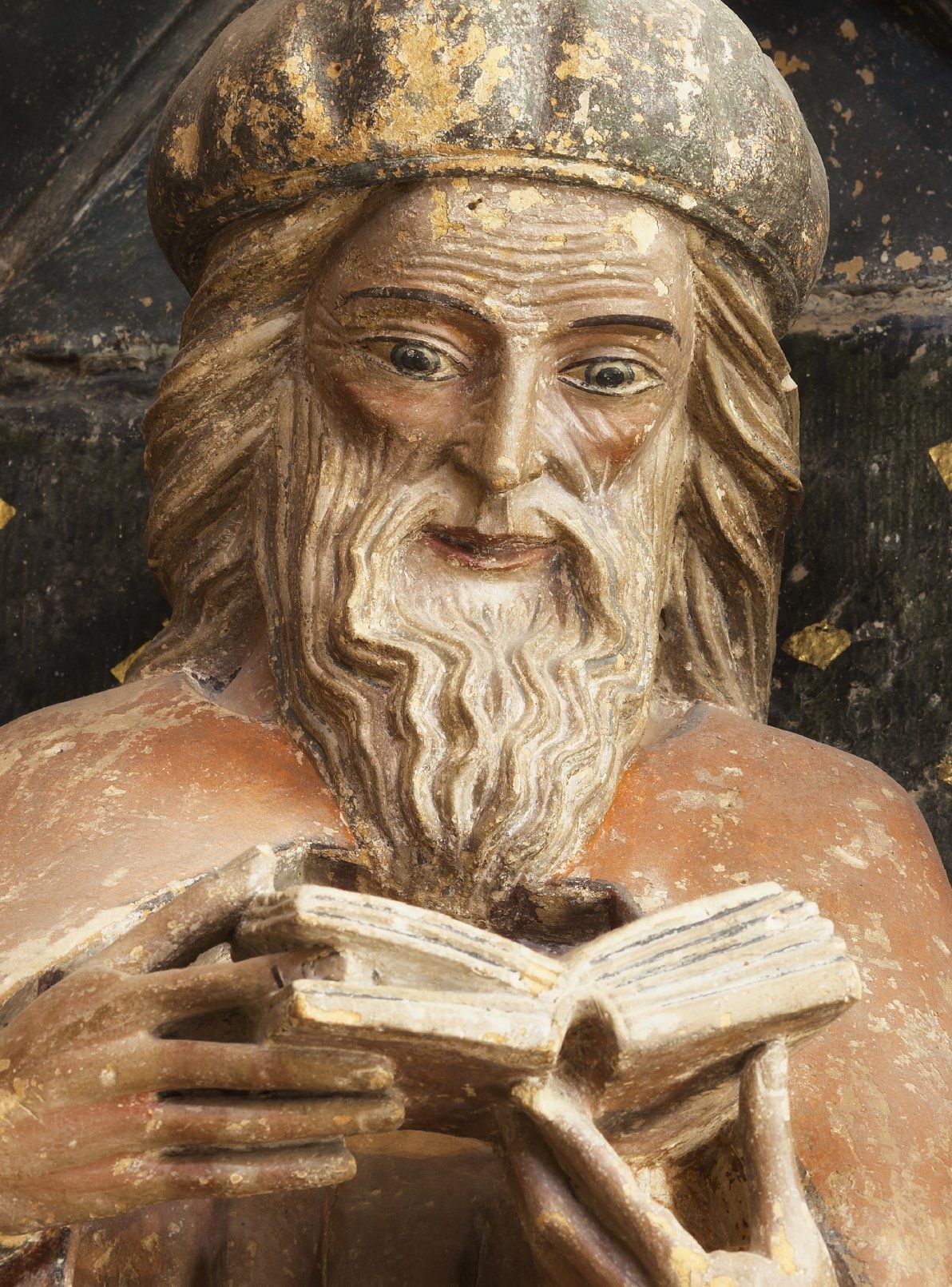
Die moralische Pflicht nach juristischem Schluss Es gibt Themen, bei denen man sofort spürt, dass es um mehr geht als um Begriffe. Es geht um Haltung, um Verantwortung und um hier geht es um eine zentrale Frage: Wann endet Schuld? Verjährung ist einer dieser Begriffe. Ein juristisches Wort, das sachlich und nüchtern wirkt – und doch von Bedeutung ist. Denn wenn ein Missbrauch verjährt ist, bedeutet das rechtlich nur eines: Die Tat kann strafrechtlich nicht mehr verfolgt werden. Aber bedeutet das auch, dass sie vergeben ist? Dass die Schuld erloschen ist? Für die Christianer scheint genau das der Fall zu sein. In ihren Aussagen, in ihrem Verhalten und vor allem in ihrem Schweigen wird eines deutlich: Verjährung wird dort wie ein Schlussstrich behandelt. Als wäre damit alles erledigt. Als gäbe es nichts mehr zu klären. Doch genau das ist ein fataler Irrtum. Denn Verjährung bedeutet nicht, dass nichts geschehen ist. Sie bedeutet lediglich, dass das Gesetz nicht mehr greift. Die Verantwortung aber bleibt – und sie wird nicht kleiner mit der Zeit. Im Gegenteil: Sie wächst, weil sie zu lange ignoriert wurde. Sie wird mit den Jahren immer größer. Was mich besonders erschüttert, ist der Umgang der Christianer mit dieser Verantwortung. So, als wäre sie mit der Verjährung abgeschlossen – wie ein Befreiungsschlag. Dabei geht es hier nicht um ein juristisches Detail. Es geht um die Frage, wie eine christliche Gemeinschaft mit Schuld umgeht, wenn sie glaubt, dass die Zeit allein sie auflöst. In diesem Kapitel geht es um genau diesen Irrtum: die Gleichsetzung von Verjährung und Unschuld. Und um das Schweigen einer Institution, die eigentlich Klarheit schaffen müsste. Denn die zentrale Frage ist nicht: „Was ist verjährt?“, sondern: „Was ist noch offen?“ Und genau daran entscheidet sich, ob eine Gemeinschaft wirklich christlich handelt – oder ob sie Täter schützt, weil es bequemer ist, als Verantwortung zu übernehmen. Verjährung ist keine Entschuldigung – sie ist ein Prüfstein Genau diesen Unterschied aber lassen die Christianer systematisch verschwimmen. Sie ziehen sich auf das Gesetz zurück und tun so, als sei mit dem Ablauf der Verjährung jede moralische Verpflichtung erledigt. Als könne man das Thema einfach abhaken und so tun, als gäbe es nichts mehr zu sagen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Verjährung ist kein Freispruch. Sie ist kein Beweis von Unschuld. Und sie ist kein legitimer Vorwand, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Sie ist schlicht eine juristische Grenze. Nicht mehr – aber auch nicht weniger. Unser Gesetzgeber hat diese Problematik erkannt und die Verjährungsfristen bei sexuellem Missbrauch inzwischen deutlich erhöht. Würde heutiges Recht auf meinen Fall angewendet, wäre die Tat erst im Jahr 2026 verjährt. Nach heutigem Recht wäre es also längst zu einem Prozess gekommen. Doch damals, als der Missbrauch geschah, galten noch deutlich kürzere Fristen. Und deshalb verjährte die Tat bereits im Jahr 2006. Doch hier geht es nicht um Paragrafen, es geht um Moral. Und gerade eine Gemeinschaft, die sich auf christliche Werte beruft, darf sich an dieser Stelle nicht verstecken. Denn wer christliche Ethik ernst nimmt, weiß: Gerechtigkeit endet nicht dort, wo das Strafrecht endet. Sie beginnt oft genau dort, wo das Gesetz aufhört – dort, wo Haltung gefragt ist, wo Mut gefordert ist, Verantwortung zu übernehmen, auch dann, wenn es unbequem wird. Die Haltung der Christianer, Verjährung als Entlastung darzustellen, ist nicht nur unzureichend – sie ist brandgefährlich. Denn sie vermittelt ein Bild, dass mit dem Verstreichen einer Frist auch die Schuld verschwindet. Dass niemand mehr Rechenschaft ablegen muss. Dass auch die Opfer bitte endlich schweigen und zur Ruhe kommen sollen. Aber so funktioniert Aufarbeitung nicht. Und so entsteht keine Gerechtigkeit. Nicht im Recht – und erst recht nicht im Glauben. Schweigen als Schutzschild – und das gefährliche Signal an Täter Noch fataler wird es, wenn man sich anschaut, was aus dieser Haltung in der Praxis geworden ist. Denn das Schweigen der Christianer, ihr Berufen auf Verjährung, ist nicht neutral. Es ist ein Signal, das sich an die Täter richtet: Du musst nur lange genug warten – und du wirst verschont. Du musst nichts bekennen. Du musst nichts aufarbeiten. Du darfst bleiben – genau wie du bist. In meinem Fall ist der Täter bis heute Teil der Gemeinschaft. Er wurde nie zur Rechenschaft gezogen, nie öffentlich benannt. Er unterliegt keinerlei Einschränkungen. Und er hat sich zu keinem Zeitpunkt um Wiedergutmachung bemüht für den Schaden, den er angerichtet hat. Trotz allem, was bekannt war – trotz aller Hinweise und bekannten Fakten. Und es bleibt nicht bei diesem einen Fall. Denn wer einen Täter duldet, ohne klar Stellung zu beziehen, schafft Strukturen, in denen auch andere Täter geschützt werden. Auf dem zentralen Konferenzgelände der Christianer gibt es beispielsweise einen Bereich, in dem bewusst nicht gefilmt wird. Ein Ort, an dem sich nicht nur, aber auch Täter unbeobachtet bewegen können. Und genau dort dürfen sie sich aufhalten – unter dem Vorwand, sie vor öffentlicher Aufmerksamkeit schützen zu wollen. Doch wer braucht hier eigentlich Schutz? Die Täter – oder die Opfer? Und vor allem: Wer garantiert, dass es bei diesem einen Fall bleibt oder geblieben ist? Die Erfahrungen der letzten Jahre sprechen eine andere Sprache. Christliche Werte beginnen dort, wo das Gesetz längst aufgehört hat Die Christianer bezeichnen sich selbst als christliche Gemeinschaft. Sie sprechen von Vergebung, von Nächstenliebe, von Demut. Doch all diese Begriffe verlieren ihren Wert, wenn sie nicht von echter Verantwortung begleitet werden. Vergebung ist kein Automatismus. Sie braucht Reue. Sie braucht einen offenen Umgang mit Schuld. Und sie braucht Konsequenzen. Ein Täter, der sich auf Verjährung beruft, zeigt keine Reue. Er sucht keinen Dialog. Er übernimmt keine Verantwortung. Und diejenigen, die ihn darin unterstützen, handeln nicht christlich, sondern fahrlässig und unverantwortlich. Eine Gemeinschaft, die einem solchen Täter dennoch Rückhalt gibt, stellt sich nicht auf die Seite des Evangeliums – sondern auf die Seite der Gleichgültigkeit. Hier stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit einer ganzen Gemeinschaft. Und ich muss mich, wie schon so oft, wiederholen: Wer sich auf christliche Werte beruft, aber keine Verantwortung übernimmt, verrät genau das, was er vorgibt, zu verteidigen. Wenn man Verantwortung ernst nehmt, dann steht man dazu. Verjährung mag juristisch gelten. Aber moralisch bleibt die Verantwortung bestehen. Wenn man es ernst meint mit Aufarbeitung, dann benennt man Versäumnisse. Klar, öffentlich und unmissverständlich. Es reicht nicht, zu sagen: „Wir bedauern, was geschehen ist.“ Bedauern ersetzt keine Verantwortung. Wer Verantwortung übernimmt, tut das nicht mit Andeutungen – sondern mit Konsequenz. Wenn ihr Täter nicht schützt, dann handelt jetzt Ein überführter Täter, der sich auf Verjährung beruft, zeigt keine Reue. Er übernimmt keine Verantwortung. Und wer ihn dennoch gewähren lässt, stellt den Schutz der Täter über den Schutz der Opfer. Dann gibt man Tätern keine Bühne, keine Rückzugsräume und keine stille Duldung. Dann benennt man sie, bezieht Position und schützt endlich die Richtigen. Wer auf biblischer Grundlage handelt, der nimmt sie ernst Die Bibel ist an dieser Stelle eindeutig: „Nehmt nicht teil an den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf.“ (Epheser 5,11) Das ist keine Bitte. Es ist ein Auftrag. Und Jesaja warnt: „Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis.“ (Jesaja 5,20) Was ist das für ein Verständnis von Vergebung, bei dem der Täter bleiben darf und das Opfer gehen muss? Was ist das für eine Theologie, in der Schweigen als Tugend gilt und das Reden über Unrecht als Verfehlung? Wenn man diese Verse kennt und dennoch schweigt, dann stellt sich eine ehrliche Frage: Was ist aus der eigenen Ethik geworden? Ein Geistlicher stellt sich der Wahrheit Ich weiß, was hinter den Kulissen geschieht. Ich weiß, dass das Reden über Missbrauch und über Verantwortliche als unangemessene Nachrede abgewertet wird. Dass Menschen, die Entscheidungen der Leitung hinterfragen, als illoyal oder gefährlich gelten. Ich weiß, dass sich viele Leitungspersonen als „von Gott gesetzt“ verstehen – und deshalb jede Kritik abwehren, als wäre sie ein Angriff auf Gott selbst. Doch wer so denkt, hat geistliche Leitung mit Machtanspruch verwechselt. In Wahrheit ist genau dieses Verhalten nicht geistlich, sondern sehr menschlich – und schon gar nicht biblisch. Denn wer das Reden über erlittenes Leid zur Sünde erklärt und das Schweigen über Täter zur Tugend erhebt, hat den Kern des Evangeliums nicht verstanden. Ein Geist, der Unrecht deckt, ist nicht heilig. Er ist nicht „von Gott gesetzt“. Er ist bequem und er ist zutiefst antichristlich. Wer auf der Seite der Wahrheit steht, bezieht Stellung Wer auf der Seite der Wahrheit steht, muss das zeigen. Nicht durch Imagepflege und nicht durch juristische Argumente, sondern durch eine Haltung. Und hier ist Schweigen ein Schuldeingeständnis. Ich weiß, dass viele, die dies lesen, mit sich ringen. Aber ich will eines ganz klar sagen: Jeder, der sich zu einer Gemeinschaft bekennt und das bestehende Verhalten einer Leitung akzeptiert, verkörpert damit auch ihr Narrativ. Jeder, der nicht hinterfragt, stellt sich hinter das System – und wird damit, ob er es will oder nicht, Teil der Verdrehung. Und jeder, der die Handlungsweise der Christianer unterstützt oder schweigend mitträgt, unterstützt eine Institution, die nicht christlich handelt, sondern christliche Werte mit Füßen tritt. Das ist nicht nur traurig. Es ist – in seiner Wirkung – gegen christliche Werte. Denn es verrät genau das, wofür der Glaube eigentlich steht: Wahrheit, Gerechtigkeit und Schutz der Schwachen. Und genau deshalb wenden sich heute so viele Menschen zu Recht von christlichen Gemeinschaften ab. Nicht, weil sie mit Glauben nichts anfangen könnten, sondern weil sie erleben, wie dieser Glaube im Namen der Institution verraten wird. Die Gemeinschaft der Christianer reiht sich damit ein unter all jene Kirchen und Bewegungen, deren Schweigen lauter ist als ihr Bekenntnis u nd zerstört damit nicht nur Vertrauen – sondern auch Hoffnung. Und für viele: ihren Glauben.
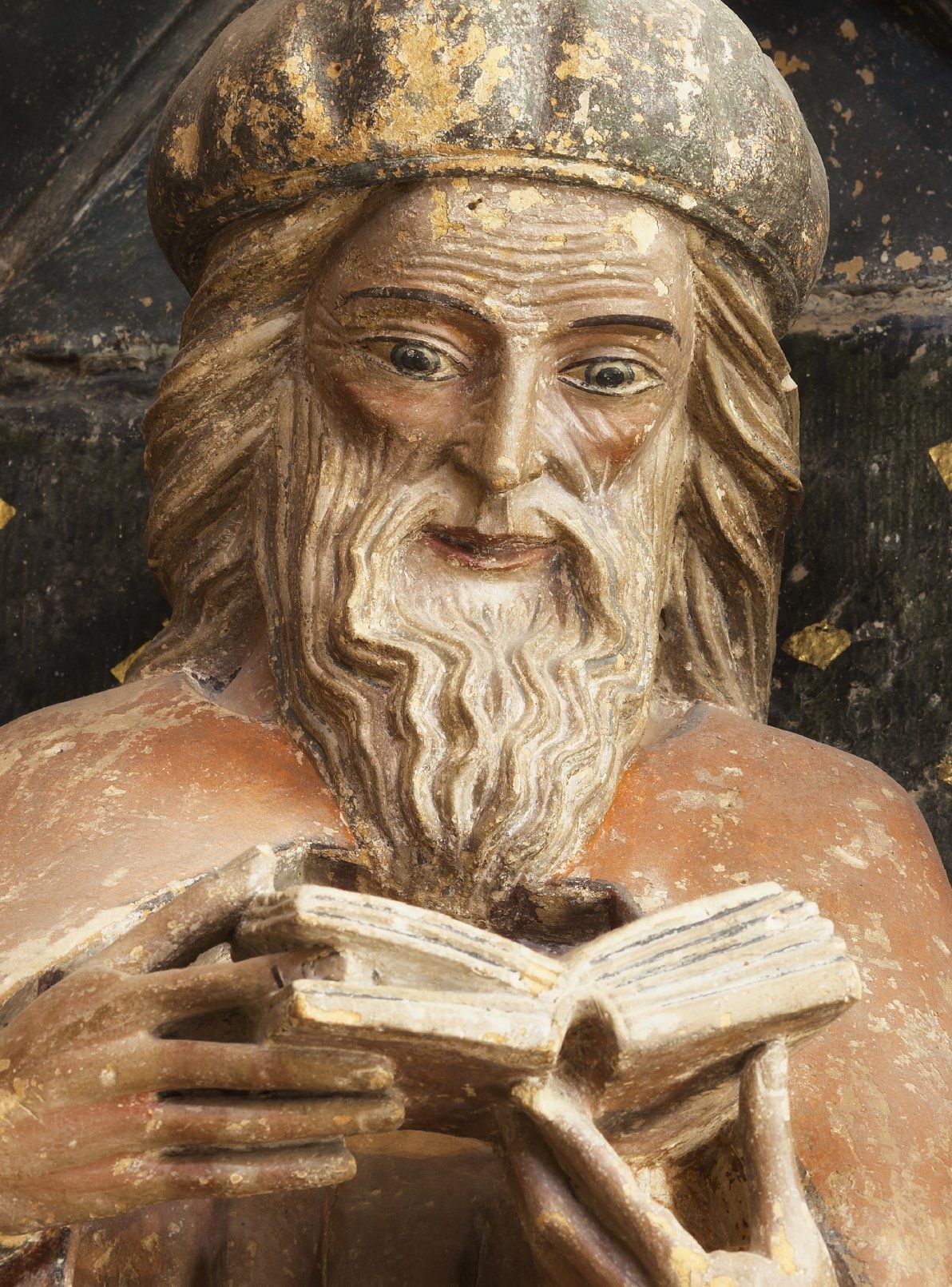
Über zehn Jahre lang schrieb und erstellte ich Inhalte für das gemeindeinterne Kindermagazin. Eine beliebteste Rubrik darin hieß „Finde den Fehler“. Zwei scheinbar identische Bilder, und doch unterschieden sie sich. Ein Stuhl fehlte oder ein Schatten war falsch. Diese Aufgabe würde für den folgenden Text auch passen. Hier jedoch nicht mit Bildern, sondern mit Worten. Und mit dem, was aus ihnen gemacht wird. Hier zeige ich ein konkretes Beispiel gezielter Manipulation: Ein sachlich verfasstes Schreiben eines Arztes, selbst Mitglied der Christianer, der sich ehrlich und konstruktiv für mich als Betroffenen einsetzen wollte. Und die völlig verdrehte Reaktion der Führungsriege: Sie unterstellen mir zum einen, der Verfasser dieses Schreibens zu sein, und zum anderen, unredliche Absichten zu haben. An dieser Stelle stellen sich entscheidende Fragen: – Wie nennt man jemanden, der bewusst einen Sachverhalt verändert und diesen sogar schriftlich dokumentiert? – Wie sicher muss sich jemand fühlen, und welches Selbstverständnis muss jemand haben, der so offensichtlich verdreht? – Wie glaubwürdig ist eine Gemeinschaft, die solche Personen in leitender Funktion weiter unterstützt oder sogar schützt? – Was soll mit dieser bewussten Verdrehung erreicht werden? – Und wenn das Ziel darin besteht, das Opfer zu diskreditieren, wie redlich sind dann diejenigen, die solche Methoden initiieren? Ich gehe hier genau diesen Fragen nach. Denn Wahrheit erkennt man oft nicht im großen Ganzen, sondern an den gezielten Verschiebungen. Das Schreiben eines Arztes, selbst Mitglied der Christianer (sinngemäße Wiedergabe) In dem Schreiben des Arztes ging es um einen sachlichen und klar formulierten Appell. Er wandte sich an den Christian Advokaten der Gemeinschaft, um sich für mich als Betroffenen einzusetzen und die Kommunikation zu verbessern. Der Arzt, selbst Mitglied der Christianer, schilderte, dass er als Arzt tätig sei, sich mit der Behandlung psychischer Erkrankungen befasse und sich sowohl medizinisch als auch menschlich für einen respektvollen Umgang einsetze. Er betonte, dass aus seiner Sicht der Schutz des Opfers oberste Priorität haben müsse und dass er die Rolle eines vermittelnden Beistands unentgeltlich übernommen habe. In dem Schreiben verzichtete er bewusst auf moralische oder theologische Bewertungen und konzentrierte sich ausschließlich auf den Aspekt des Opferschutzes. Zudem machte er unmissverständlich deutlich, dass er mich zunächst zu einer Zusammenarbeit mit dem Christian-Advokaten überreden musste, was ihm schließlich auch gelang. Er erklärte außerdem, dass meine Zurückhaltung gegenüber der sogenannten Vereinbarung nicht auf mangelnde Bereitschaft zurückzuführen sei, sondern auf nachvollziehbare Bedenken: Sicherheitsrisiken, fehlende Neutralität und eine unausgewogene Verteilung von Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft. Er führte auch an, dass ich mich mit meiner Nichtteilnahme an Veranstaltungen an ärztlichen Rat gehalten habe. So viel zum Inhalt des Schreibens. Die Antwort des Christian-Advokaten (sinngemäße Wiedergabe) In seiner Antwort schrieb der Christian-Advokat sinngemäß, dass ich mich erneut direkt an ihn gewandt hätte, obwohl er nach eigener Aussage bereits mehrfach deutlich gemacht habe, dass jegliche direkte Kontaktaufnahme künftig zu unterlassen sei. Ein solches Vorgehen, so seine Einschätzung, sei der Sache nicht dienlich und zeige, dass ich mich über seine Anweisungen hinwegsetze. Er äußerte zudem den Eindruck, ich würde die Schreiben und Mitteilungen der Gemeinschaft nicht ausreichend beachten oder sogar ignorieren. Abschließend stellte er klar, dass es sich bei dem Christianer, der das Schreiben verfasst hatte, nicht um einen unabhängigen oder außenstehenden Beistand handele, sondern um ein Gemeindemitglied. Wenn man die Schreiben wie Bilder miteinander vergleicht, würde man auf folgende Fehler stoßen: Fehler 1: Falsche Beschuldigung Die Christianer behaupten, ich selbst hätte dieses Schreiben verfasst. Doch das Schreiben stammt nachweislich von einem anderen, einem Christianer, einem Arzt und jemandem, der mich unterstützen wollte. Warum diese Lüge? Weil sie mich angreifbar machen soll und mich zum alleinigen Gegner. Eine klassische Täter Opfer Umkehr mit dem Ziel, Schuld umzulenken und meine Redlichkeit zu untergraben. Fehler 2: Missachtung eigener Richtlinien Öffentlich betonen die Christianer, dass Betroffene einen Beistand selbst wählen dürften. In der Realität aber gilt: Sobald dieser Beistand unbequem wird, gelten andere Regeln. Warum? Weil eine unabhängige Stimme gefährlich wird, vor allem dann, wenn sie die falschen Fragen stellt. Fehler 3: Ablenkung vom Inhalt Die Antwort der Christianer geht mit keinem Wort auf die Inhalte des Schreibens ein, obwohl es zwölf Seiten umfasste. Es enthielt konkrete Vorschläge, wie mit mir und dem Täter umgegangen werden könnte und was für uns als Familie tragbar gewesen wäre. Aber: Kein Wort über Opferschutz. Kein Wort über die Vereinbarung. Kein Wort über die Sicherheitsbedenken. Stattdessen: Personalisierung, Diffamierung und Ablenkung. Das Ziel: Nicht den Inhalt widerlegen, sondern den Absender diskreditieren. Fehler 4: Verdrehung der Rollen Der Beistand wird als „nicht außenstehend“ bezeichnet, als wäre er eine Art Erfüllungsgehilfe. Dabei handelte er auf eigenen Wunsch und ist selbst ein Christianer. Die Absicht: Unterstützung delegitimieren, den Kreis des Vertrauens klein halten und Kontrolle behalten. Keine Missverständnisse, sondern gezielte Manipulation Hier wurde nicht zufällig falsch verstanden. Hier wurde gezielt manipuliert, schriftlich und mit klarem Kalkül. Wer bereit ist, offensichtliche Tatsachen umzudeuten und diese Umdeutung sogar dokumentiert, der irrt nicht. Der lügt. Und wer solche Lügen deckt, stellt sich nicht auf die Seite der Wahrheit, sondern auf die Seite der Verdrehung. Wenn Lügen keine Scham mehr kennen – Dummheit oder Kalkül? Ich frage mich: Wie kommt jemand dazu, so leicht nachprüfbare Unwahrheiten zu Papier zu bringen, die sich in wenigen Minuten widerlegen lassen? Ist das Dummheit? Nein. Es ist ein Signal. Ein Signal an das Opfer und an alle, die es unterstützen: – „Wir bestimmen, was zählt.“ – „Wir haben die Deutungshoheit, nicht du.“ – „Wir lügen, weil wir es können.“ Solche Lügen entstehen nicht aus Unsicherheit. Sie sind ein Machtinstrument. Es ist das Kalkül derer, die wissen: Selbst wenn wir lügen, wird uns niemand zur Rechenschaft ziehen. Die erschütternde Erkenntnis Ein sachlicher und unterstützender Brief wird in einen persönlichen Angriff uminterpretiert. Es ist ein zielgerichtetes Manöver. Denn wer die Wahrheit nicht widerlegen kann, versucht, sie umzudeuten. Im Zentrum dieser Strategie stehen vier Mechanismen: • die bewusste Falschdarstellung eines klaren Sachverhalts • die Missachtung eigener Richtlinien • die Verdrehung der Rollen von Unterstützer und Opfer • die Ablenkung vom Inhalt durch den Angriff auf die Person Aber was soll mit dieser Lüge erreicht werden? Die Antwort ist einfach und verstörend: Das Opfer soll entwertet werden, der Unterstützer diskreditiert. Eine berechtigte Kritik soll unterbunden werden, ohne sich mit der Sache beschäftigen zu müssen. Und all das im Namen einer Gemeinschaft, die vorgibt, auf Wahrheit gegründet zu sein. Doch Wahrheit, die verdreht wird, ist keine Wahrheit mehr. Sie ist eine Lüge im Gewand der Redlichkeit, ein Etikett auf der Täuschung. Was sagt die Bibel zu denen, die genau dies tun? In den Zehn Geboten heißt es: „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.“ (2. Mose 20,16) Und dennoch ist genau das hier bewusst, schriftlich und systematisch geschehen. Und weiter heißt es: „Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft, und wer Lügen redet, wird nicht entkommen.“ (Sprüche 19,5) Ein klareres Schlusswort könnte man kaum geben. Denn wer Wahrheit bewusst verdreht, stellt sich nicht nur außerhalb jeder Verantwortung, er verlässt auch das Fundament, auf das er sich selbst beruft.
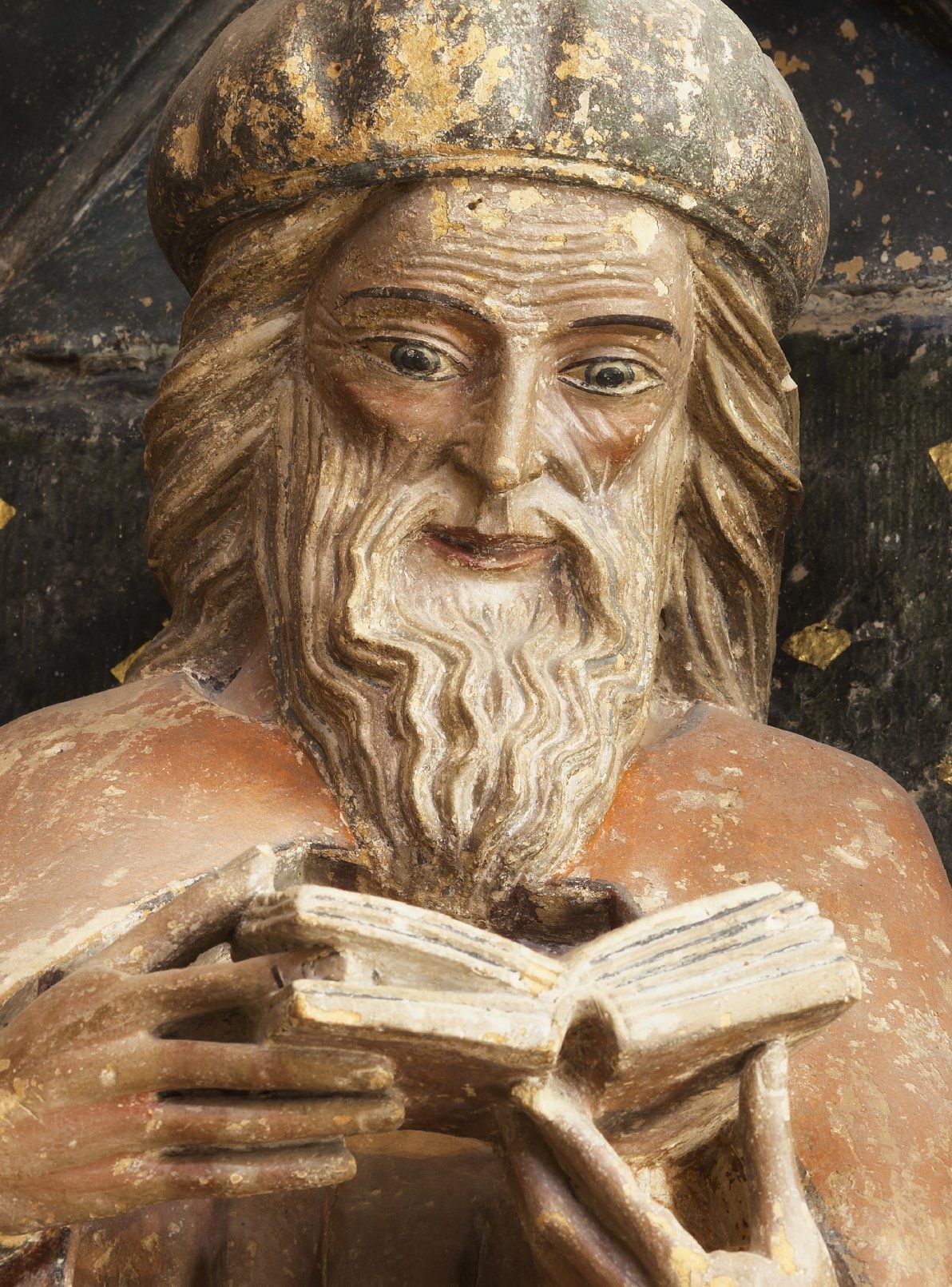
Nähe statt Neutralität Ich rede vom Team, von jenen Personen, die der Gemeinschaft nach dem Offenlegungsgespräch vorstehen und die dennoch alles daransetzten, die Situation nicht aufzuklären, sondern zu verwalten, als ginge es um Schadensbegrenzung, nicht um Gerechtigkeit. Es sind Menschen, mit denen ich über Jahre freundschaftlich verbunden war. Was ich erlebte, hatte mit Barmherzigkeit nichts mehr zu tun. Es ging um institutionelle Interessen, um den Schutz des Apparats, um gezielten Machterhalt. Die ursprüngliche geistliche Dimension war längst überlagert von strategischem Verhalten, das einzig dem Fortbestehen der eigenen Ordnung diente. Ich möchte in Folgendem zeigen, wie ein System funktioniert, das Täter schützt, durch Absprachen hinter verschlossenen Türen oder durch ein kollektives Wegsehen, das weit über bloße Passivität hinausgeht. Denn das, was hier geschehen ist, war kein Unfall oder tragisches Missverständnis. Und es ist auch kein Mangel an Empathie. Es war das Ergebnis eines Systems, das gelernt hat, sich selbst zu verteidigen und dabei bereit ist, die Wahrheit zu opfern, die Gerechtigkeit zu verschieben und die christlichen Werte zu verraten, auf die es sich öffentlich beruft. Aktiv und in vollem Bewusstsein. Erst durch meine Veröffentlichung habe ich Kontakt zu weiteren Betroffenen erhalten. Mir wurden von einer Fachperson die „Big Five“ bekannt gemacht, also fünf Personen, die sich sofort als Betroffene zu erkennen geben würden, sobald ich mich öffentlich zu meiner Geschichte äußere. Dabei ist es unerheblich, ob ihre Täter aus dem Umfeld der Gemeinschaft oder aus einem anderen stammen. Tatsache ist: Sie alle haben sexuelle Gewalt erfahren. Und genauso kam es. Diese Erkenntnis hat mich tief erschüttert. Über Jahre lebte ich in dem Glauben, ein Einzelfall zu sein. Eine tragische Ausnahme, die sich nie wiederholen würde. Heute weiß ich: Das war ein Irrtum, und das war schmerzhaft. Noch gravierender ist jedoch: Die Leitung kennt diese Fälle. Sie wusste, dass es nicht nur mich betrifft. Und trotzdem wurde nichts unternommen, um andere Betroffene vor „meinem“ Täter zu schützen. Vielleicht ist nicht allen klar, was mit dem Begriff „Schutz der Betroffenen“ konkret gemeint ist. Deshalb hier nochmals verständlich und auf Deutsch: Der Schutz Betroffener sexueller Gewalt bedeutet, dass eine Gemeinschaft innerhalb ihres Verantwortungsbereichs alles dafür tut, dass ein bekannter Missbrauchstäter keinen Zugang zu Kindern oder Jugendlichen erhält und dass er keinen Kontakt zu Menschen hat, die bereits Opfer sexueller Gewalt wurden. Das ist keine Idealvorstellung. Das ist der absolute Mindeststandard, ethisch, rechtlich und moralisch. Eine Verantwortung, zu der jede Institution verpflichtet ist, unabhängig von ihrem Selbstverständnis, ihrem Glaubenssystem oder ihrer inneren Ordnung. Auch wenn sie an den heiligen Regenwurm glauben sollte. Wenn eine solche Schutzmaßnahme ausbleibt, ist das kein Versehen und keine Unachtsamkeit. Es ist ein struktureller Akt institutioneller Verantwortungslosigkeit. Und an diesem Punkt geht es längst nicht mehr nur um meine persönliche Geschichte. Hier geht es um Prinzipien. Um universelle Schutzmechanismen, die längst hätten greifen müssen und die in diesem Fall systematisch außer Acht gelassen wurden. Wenn Täterfreunde Aufarbeitung betreiben Die Zusammensetzung des sogenannten Aufarbeitungsteams zeigt mit erschreckender Deutlichkeit, wie wenig hier wirklich verstanden wurde. Beide heutigen Gemeinde-Christian wussten und wissen vom Missbrauch. Und dennoch ließen sie den Täter in ihrer Gemeinde gewähren. Sie hielten ihn nicht von Kindern fern, im Gegenteil. Und genau diese Personen sind heute Teil jenes Teams, das offiziell mit der Aufarbeitung betraut ist. Wie soll ein Team glaubwürdig arbeiten, wenn zentrale Mitglieder selbst in die Vorgänge verwickelt sind? Wenn diejenigen, die über Versäumnisse aufklären sollen, selbst dafür verantwortlich sind? Ein Beschuldigter soll zugleich Aufklärer und Richter sein? Das ist nicht nur widersprüchlich, es ist ein eklatanter Interessenkonflikt. Und im Kern nichts anderes als institutionelle Selbstverteidigung. Doch noch dazu: Alle Mitglieder dieses Teams stehen in engem familiären Verhältnis zueinander. Sie sind verbrüdert oder verschwägert und dem Täter freundschaftlich sowie im theologischen Sinn „brüderlich“ verbunden. Ich habe diese Konstellation mehrfach und auch schriftlich kritisiert. Ich habe mich an den obersten geistlichen Leiter der Gemeinschaft gewandt, mit der Bitte, ein unabhängiges Team einzusetzen, ein Team, das nicht durch persönliche Loyalität oder emotionale Nähe belastet ist. Ein Team, das neutral und glaubwürdig arbeiten kann. Die Antwort war ernüchternd: Er arbeite seit vielen Jahren vertrauensvoll mit diesen Personen zusammen. Das erinnert mich an ein Zitat, das bei der Vorstellung des Freiburger Missbrauchsberichts fiel. Dr. Endres zitierte den damaligen Erzbischof Dr. Saier mit den Worten: „Über meine Priester lasse ich nichts kommen.“ Offenbar gilt auch hier ein ähnliches Prinzip: Loyalität vor Wahrheit, Verteidigung vor Aufklärung und Nähe zum Täter vor Gerechtigkeit für das Opfer. Selbstschutz statt Transparenz Personen, die ich mir als neutrale Begleitung gewünscht hatte, aus meiner Sicht glaubwürdig, integer und unabhängig, wurden konsequent abgelehnt und ausgeschlossen. Offenbar war genau das das Problem: ihre Unabhängigkeit. Stattdessen bestimmten die Verantwortlichen selbst, wer Teil des Teams ist. Sogar Mitglieder des Kinderschutzteams der Ortsgemeinde wurden gezielt in meinem Zusammenhang aus dem Team entfernt. Diejenigen, die für die Aufarbeitung verantwortlich gemacht werden, definieren die Spielregeln und kontrollieren gleichzeitig den Prozess. Das ist nicht unabhängig. Das ist struktureller Machtmissbrauch im Gewand der Aufklärung. Und es zeigt noch etwas: Nicht einmal die eigenen Richtlinien zum Umgang mit sexuellem Missbrauch wurden eingehalten, jene, mit denen sie öffentlich werben. Den Praxistest haben sie nicht bestanden. Ein Konzept, das nicht gelebt wird, ist kein Konzept. Es ist ein Feigenblatt.
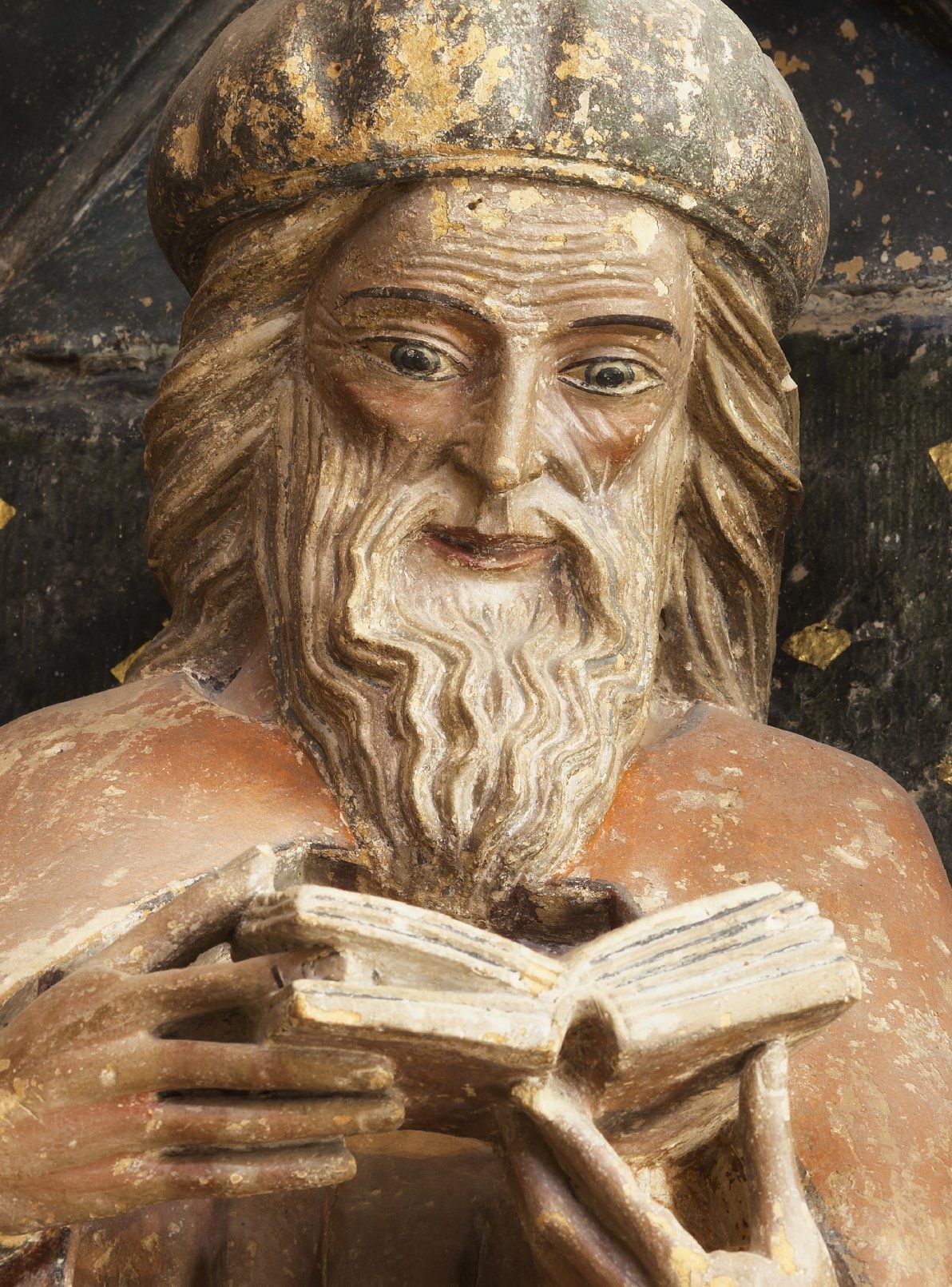
Als Jesus von den Römern unschuldig verurteilt und ans Kreuz geschlagen wurde, sprach er – in einem der wohl bewegendsten und meistzitierten Sätze der Bibel: „Vater, vergib ihnen – denn sie wissen nicht, was sie tun.“ (Lukas 23,34) Dieser Moment steht sinnbildlich für christliche Barmherzigkeit. Für die Größe eines Menschen, der selbst in tiefster Erniedrigung noch Fürbitte für seine Peiniger leistet. Für viele Christinnen und Christen ist dieses Wort ein Inbegriff von Gnade, Demut und Vergebung. Doch was ich erlebt habe, steht in scharfem Kontrast zu genau diesem Satz. Nicht, weil es sich gegen Vergebung richtet, sondern gegen ihre Verdrehung. Denn ich werde an meinem Beispiel zeigen, dass die Verantwortlichen einer freikirchlichen Gemeinde genau wussten, was sie taten. Es geht nicht um Unwissenheit, nicht um Missverständnisse, nicht um einen tragischen Irrtum. Es geht um gezielte, strategische, institutionell abgesicherte Einflussnahme und darum, Wahrheit zu verzerren, Verantwortung abzulenken und um jeden Preis den eigenen Ruf zu schützen. Genau deshalb sage ich: Denn sie wissen genau, was sie tun. Dieser Satz ist keine Provokation. Er ist das Resultat eines langen, teils auch schmerzhaften und präzise dokumentierten (gespielten) Aufarbeitungsprozesses, der diese Bezeichnung nicht verdient. Denn am Ende stand eine nüchterne Erkenntnis: Nicht Unkenntnis, nicht Überforderung, nicht Naivität – sondern Kalkül, Selbstschutz und institutionelle Strategie formten das Bollwerk aus Abwehr und Verdrehung. Es zeigt, was geschieht, wenn Menschen ein System dazu nutzen, sich selbst zu schützen, statt sich ihrer Verantwortung zu stellen. Wenn Loyalität zur Struktur höher bewertet wird als das Leid eines Einzelnen. Wenn das Ansehen eines Täters mehr zählt als das Wohlergehen eines Betroffenen. Ich will nicht nur dokumentieren. Ich will auch herausfordern und Klarheit schaffen. Damit diese Strategien, die Täter schützen, nicht länger hinter religiösen Floskeln verborgen bleiben und versteckt werden können. Anspruch und Realität „Wer dem Geringsten Gewalt tut, spottet dessen Schöpfer.“ (Sprüche 17,5) Dieser Vers ist eine der zentralen Botschaften, die diese Glaubensgemeinschaft zentral propagiert. Dort wird diese Bibelstelle als Grundlage geistlicher Verantwortung hervorgehoben: Verantwortung übernehmen, Fürsorge leben und die Ethik ernst nehmen. Doch meine Erfahrung zeigt eine bittere Realität. Eine, die dem Anspruch diametral entgegensteht: Wer diesen Vers als geistliches Leitbild verkündet und zugleich zulässt, dass ein Opfer öffentlich herabgewürdigt wird, um eigene Versäumnisse zu verschleiern, während der Täter im System verbleiben darf , der verspottet nicht nur den Schöpfer. Er entwürdigt den Glauben selbst. Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit wird nirgends so deutlich wie dort, wo geistliche Autorität dazu benutzt wird, Verantwortung zu umgehen oder aktiv zu verschleiern. Das ist nicht Barmherzigkeit, das ist Hohn. Das ist nicht christlich, das ist antichristlich.

Sexuell missbraucht zu werden ist ein so tiefgreifender Einschnitt in die Persönlichkeit eines Kindes, der sich auf die Entwicklung und den ganzen weiteren Lebensverlauf auswirkt. Der Schritt mit meiner persönlichen Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, war gut überlegt und wohl abgewogen. Da ich weiß, dass auf dem Gebiet des sexuellen Missbrauchs viel Unsicherheit und Unwissenheit herrscht, möchte ich damit vor allem zu mehr Klarheit und Verständnis für die Anliegen Betroffener beitragen und auf einen gravierenden Missstand hinweisen. In meinen Augen ist es ein weiteres Verbrechen, dass Vertreter einer christlichen Institution, aus Feigheit Verantwortung übernehmen zu müssen und vor der Angst einen Ruf zu verlieren, mit einer Willkür handeln können und damit Betroffene enorm belasten. Ich war Unternehmer, habe eine Familie und dachte, ich hätte eigentlich alles ganz gut im Griff. Mit Anfang 40 holte mich ein Verbrechen ein, welches in meiner Kindheit an mir begangen wurde. Als 9-jähriges Kind wurde ich über mehrere Jahre von einem Mann sexuell missbraucht. Unsere Wege kreuzten sich in einer freikirchlichen Gemeinschaft. Bei der Straftat reden wir unter anderem von Befingern des Genitals (auch während des Schlafs), Einläufen unter dem Vorwand der gesundheitlichen Notwendigkeit bis hin zur analen Vergewaltigung. Die Folge einer Verletzung begleitet mich bis heute. Die Taten fanden im privaten Rahmen statt. Doch bereits in der Anfangszeit des Missbrauchs wurden verantwortliche Personen dieser Gemeinschaft von einem Gemeindemitglied auf konkrete Anzeichen von Missbrauch aufmerksam gemacht. Später heiratete der Täter und adoptierte trotz seiner Vorgeschichte zwei Kinder. Für mich stand damals der Schutz der Kinder im Vordergrund: Melde ich den Missbrauch, würden sie wieder ihr neues Zuhause verlieren. Dass ich sie damit auch in Gefahr brachte, war mir damals nicht bewusst. Die Gedankenwelt eines Betroffenen folgt einer eigenen Logik. Für mich gab es noch weitere gravierende Gründe, die Tat nicht aufzudecken. Der andauernde Täterkontakt und die für mich ausweglose Situation brachten mich zu zwei Versuchen mein Leben zu beenden, die glücklicherweise scheiterten. Im Jahr 2000 offenbarte ich den Missbrauch genau denen, die bereits damals involviert waren. Am Verhalten des Täters war jedoch keine Änderung erkennbar und dieser Mensch, der sich der Straftat des schweren sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht hatte, lebte in der Gemeinschaft unbeschwert ohne erkennbare Einschränkungen weiter. Zu diesem Zeitpunkt war die Tat noch nicht verjährt. Die allgemeinen Gemeindemitglieder wurden darüber nicht informiert, damit sie ihre Kinder von dem Täter hätten fernhalten können. Auch im örtlichen Sportverein konnte er weiter als Trainer tätig sein. Die Verantwortlichen der Gemeinschaft, bis hin zur obersten Gemeindeleitung, wussten zu diesem Zeitpunkt, dass sich ein Straftäter in ihren Reihen befindet. Welche Gründe letzten Endes ausschlaggebend für den Beginn meines Zusammenbruchs waren, kann ich nicht genau benennen. Eine Beobachtung jedoch, wie der Täter auf dem Gemeindeplatz die Kinder einer Mutter, die in einer familiären Notsituation war und kein eigenes Auto hatte, eigenhändig in den Kindersitz seines Autos setzte und sie anschnallte, war eine davon. Dass es möglich ist, dass ein pädophiler Straftäter sich hilfsbedürftigen Kindern nähert, konnte ich nicht länger akzeptieren. Das Fass zum Überlaufen brachte dann folgende Begebenheit: Der Mann, dem ich damals den Missbrauch offenbarte und der heute einer der Gemeindeleiter ist, ging mit meinem Sohn zum Täter, um Holz in seiner Garage einzustapeln. Später wird der Täter ein Video der Begebenheit auf seinem Instagram-Account veröffentlichen. Es war ein schleichender Prozess, in dem mir mehr und mehr die Energie schwand und mir mein Leben völlig entglitt. Unfähig einen klaren Gedanken zu denken, hörte ich im Radio eine Reportage, in dem der Weiße Ring erwähnt wurde. So nahm ich mein Telefon und wählte die Notfallnummer und wurde umgehend an die Kriminalpolizei weiterverwiesen. Auf Anraten der Kriminalpolizei ließ ich den Fall anwaltlich überprüfen und nahm Kontakt mit der Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt auf. Schnell wurde klar, dass die Tat verjährt ist. Während den Gesprächen mit der Beratungsstelle wurden allerdings auch die Verwicklungen der freikirchlichen Gemeinschaft deutlich. Dass ich mit dem Thema keine offenen Türen einrenne, war von vornherein klar. Deshalb hatten wir uns entschieden die Gemeinschaft im Rahmen eines Offenlegungsgespräches in den Räumlichkeiten des Landratsamtes unter Anwesenheit eines Sozialarbeiters, eines Anwaltes und Vertreter der Kirchengemeinde förmlich zu informieren. Infobox Prof. Dr. Gerald Hüther zum Thema Kohärenz. Was dann passierte, ist für mich bis heute nicht nachvollziehbar. Da das Narrativ der verantwortlichen „Geistlichen“, die bereits Jahrzehnte von dem Missbrauch in Kenntnis waren, ihrer Einschätzung nach und Grund ihres Amtes unfehlbar sind („von Gott gesetzt“), wurde der Akt der Offenlegung als „Majestätsbeleidigung“ aufgefasst. Sogleich wurde ich zum Angreifer der Gemeinschaft und als ein Werkzeug des Bösen (infrage stellen der „Heiligen“) stilisiert, der zudem nicht vergeben könne. Auch wurde den Gemeindemitgliedern deutlich nahegelegt, nicht über das Thema zu reden um so wenig Unruhe wie möglich entstehen zu lassen. Ein Aufarbeitungsprozess konnte gar nicht erst beginnen. Selbst die eigenen Leitfäden und auch Empfehlungen, wie die der Aufarbeitungskommission, wurden ignoriert und abgelehnt. Mich als Nestbeschmutzer loszuwerden war eigentlich ganz einfach. Damit ein Betroffener eine Therapie beginnen kann, wird von ihm ein absoluter Abbruch des Täterkontaktes verlangt. Es ist eine Kontraindikation und die Voraussetzung überhaupt eine Therapie beginnen zu können. Obwohl ihnen dies klar kommuniziert wurde, haben sie eine Vereinbarung mit dem Täter getroffen, die ihm eine abwechselnde Teilnahme an den Gemeindeveranstaltungen garantiert. Mal er, mal wir – eine 50:50-Regelung also. Dies ist für uns als Familie natürlich nicht tragbar gewesen und hatte nichts mit einer Ideologie, sondern rein mit pathologischen Gründen zu tun. Für uns, und insbesondere für unsere Kinder, bedeutete dies den abrupten Abbruch nahezu aller Freundschaften und Vertrauenspersonen. Um meine Situation besser beschreiben zu können, mache ich dies anhand eines früheren Erlebnisses deutlich: Vor vielen Jahren meinte ich, mit einem Freund recht untrainiert die Zugspitze hochwandern zu müssen. Nach einem mehrstündigen kontinuierlichen Aufstieg erreicht man die Wiener Neustädter Hütte. Dort pausierten wir kurz und machten uns schließlich zum Endaufstieg auf. Nach der Hütte muss man ein größeres Geröllfeld durchwandern. Und da versagte mein Körper. Die Waden und alle möglichen Muskeln krampften und ich war unfähig selbst kleine Schritte zu gehen. So fühlte ich mich während meiner gesamten Depression. Während ich mich mit meiner eigenen Unfähigkeit und Hilflosigkeit abkämpfte, mussten dazu noch die anderen großen Baustellen gemanagt werden. Die emotionale Belastung für die Familie, insbesondere die der Kinder, die unternehmerischen Tätigkeiten und die Aufarbeitung mit der christlichen Gemeinschaft. Dies war schlichtweg zum Scheitern verurteilt. Und so führte die Spirale immer weiter und immer tiefer nach unten. Infobox: Rechte und Pflichten Aufarbeitung in Institutionen (Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs Welche Auswirkungen auf meine Persönlichkeit der Missbrauch und die Umstände über die nun mehr als 30 Jahre hatten und warum es zu Verhaltensweisen und Überlebensstrategien führte, die nahezu selbstzerstörerisch sind, können Fachleute erklären. Für mich war es jedoch eine große Herausforderung überhaupt erstmal Emotionen und Gefühle als Mensch im mittleren Alter kennenzulernen, sie für mich zu deuten und damit umgehen zu lernen. Ich war in einem Modus, in dem ich nur noch primitive Lebensaufgaben ausführen konnte. Um dies zu verdeutlichen, kann ich es vielleicht an einem Beispiel aus einem Gespräch mit meiner Therapeutin. Ich sollte 10 machbare Aufgaben auf einen Zettel schreiben und die Aufgabe war, jeden Tag mindestens eine davon zu beginnen - und zu erledigen. Dann sagte sie: „Wenn dein Körper dann schlafen will, dann schlafe. Und wenn er laufen will, dann laufe. Aber die Aufgabe muss zuerst erledigt werden.“ Hierbei muss ich anmerken, dass es schon zu meiner Jugendzeit eine meiner Arten der Konfliktbewältigung war, zu jeder Tages- und Nachtzeit, manchmal bis ins Morgengrauen, durch Wiesen und Wälder zu tigern. An komplexe Tätigkeiten war überhaupt nicht mehr zu denken. Mich auf etwas zu konzentrieren fiel mir enorm schwer und war zeitweise überhaupt nicht möglich. Für meine Kundschaft, die darauf angewiesen war, dass ich rund um die Uhr für sie erreichbar bin und ich für sie oft innerhalb kurzer Zeit in komplexen Aufgabenstellungen Lösungen finden musste, war dieser Zustand verständlicherweise nicht tragbar. Mit meinem Abtauchen war es die logische Konsequenz, dass sie sich andere Geschäftspartner suchen mussten. Den Unmut, den ich dadurch hervorgerufen habe, kann ich niemanden verdenken und ist nur allzu verständlich. Das Gemeine an der Sache war, dass, während meine Welt stillstand, sich alle anderen Mühlen kontinuierlich weiterdrehten. Der finanzielle Schaden war immens. Nicht nur, dass ich wegen der Verjährung für alle Kosten meines Rechtsbeistandes und für die Maßnahmen für meine Genesung selbst aufkomme, hatte ich durch die Zeit einen kompletten Verdienstausfall. Schließlich führte dies zur Aufgabe meiner zwei gut laufenden Firmen. Noch immer machen mir meine körperlichen Einschränkungen zu schaffen. Auch möchte ich mich schlichtweg nicht weiter für die Schuld anderer rechtfertigen und entschuldigen müssen, die mich drei Jahre aus dem Leben gerissen hat. Mittlerweile haben wir unser Geröllfeld überwunden und kämpfen uns langsam, aber stetig, wieder zurück ins Leben. Meine Energie und Kreativität kehren zurück und wir blicken mit Zuversicht in die Zukunft. Denn was sich bereits entwickelt hat, ist nahezu unbeschreiblich. Natürlich gibt es Rückschläge und der Berg an Herausforderungen scheint nicht weniger zu werden. Dennoch möchte ich rückblickend sagen, dass es sich gelohnt hat den Kompass neu zu kalibrieren und selbstbestimmt und aufgeräumt in ein neues Leben zu starten. Aus diesem Grund möchte ich jeden dazu ermuntern, der in einer ähnlichen Situation steckt, auch wenn es eine große Herausforderung bedeutet, die Sache anzupacken und mit seinem Leben aufzuräumen. Darum sage ich mit breiter Brust: „Come on – get a life!“ Song: Lasst uns leben - Marius Müller Westernhagen





