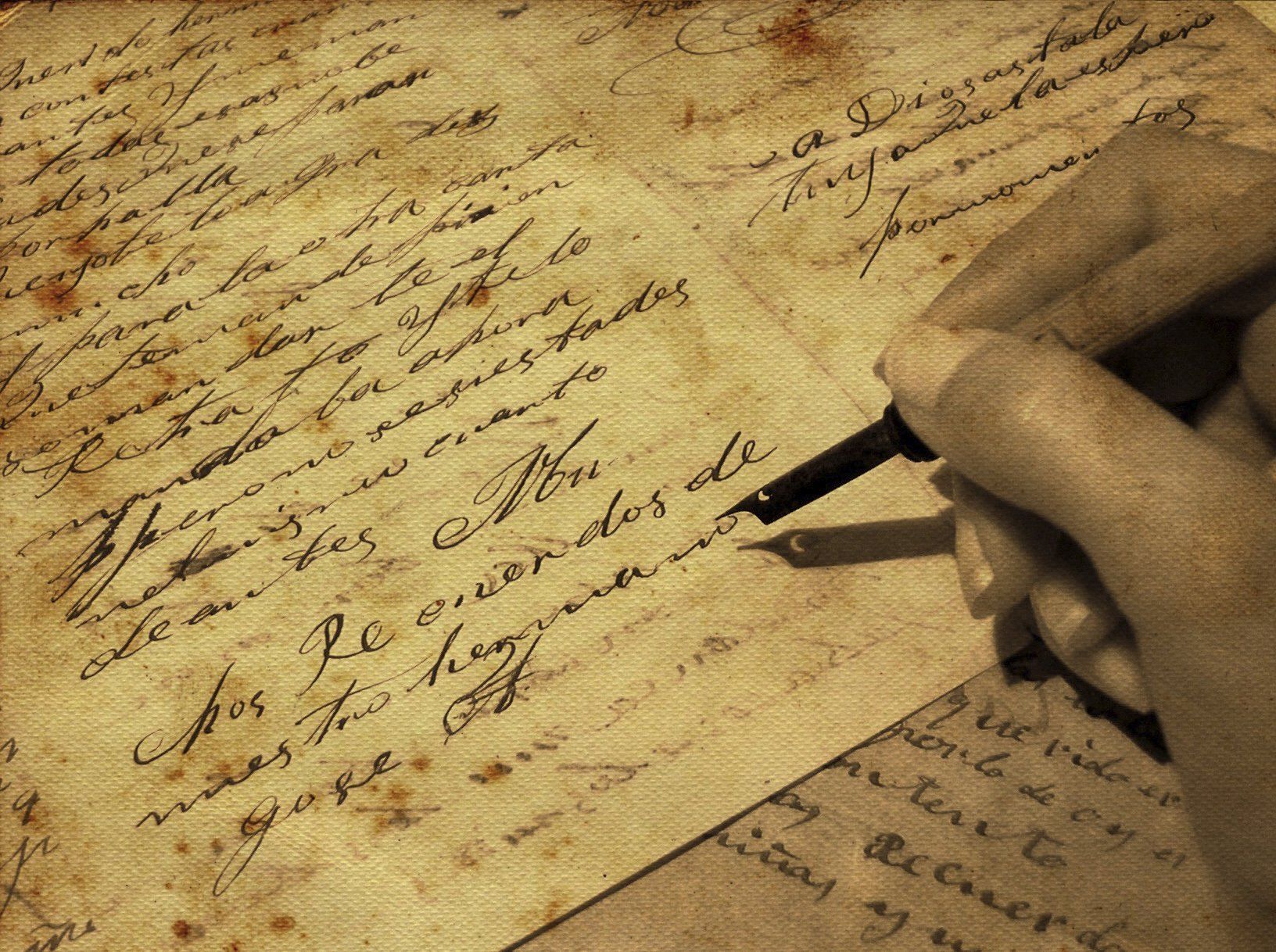Denn sie wissen genau was sie tun - Der Anfang
Denn sie wissen genau was sie tun - Der Anfang eines nicht veröffentlichten Romans
Peter
Wir sind in einem kleinen Dorf in den bayerischen Voralpen. Besser gesagt: Es ist eigentlich ein Dörfchen. Umgeben ist dieses Dorf von Feldern und kleinen Wäldchen. Die meisten Felder gehören dem einzigen Bauern im Ort. Er ist ein fleißiger Mann, der emsig seine Felder bestellt, sich fürsorglich um seine paar Dutzend Tiere kümmert und den Ertrag vermarktet. Für Einkäufe muss man ins nahegelegene Nachbardorf fahren.
Dies nennt Peter sein Zuhause – seine Heimat, wie er sagt. Dort fühlt er sich wohl, und von dort will er auch nicht mehr weg. Er zieht nur noch ein einziges Mal um: in einem weich ausgekleidetem, schön geschmückten Holzbett. Für diesen letzten Umzug wünscht er sich, dass der Bauer Paul ihn mit seiner alten Kutsche und zwei stolzen Pferden zu seiner letzten Ruhestätte fährt. Da hat er klare Vorstellungen.
Peter ist Ende 50 und arbeitet beim Jugendamt in der Landeshauptstadt. Er ist Leiter der Abteilung, die sich um sexuelle Gewalt an Kindern kümmert. Seit er in sein Arbeitsleben eingetreten ist, arbeitet er beim Jugendamt. Zuerst war er im allgemeinen sozialen Dienst tätig und verbrachte seine ersten Jahre damit, Kindern aus oft bildungsfernen Familien eine Grundlage für die Zukunft zu ermöglichen. Es war reiner Zufall, dass er bei einer Fortbildung den Leiter der Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern traf. Es wurde ein langer Abend, und am Ende meinte dieser, er solle besser gestern als heute in seine Abteilung wechseln. Seitdem ist er dort. Schließlich machte man ihn zum Abteilungsleiter. Unzählige Fälle hat er begleitet und kam in Kontakt mit leichten Vergehen – aber auch mit den abscheulichsten Gräueltaten an Kindern, die man sich vorstellen kann.
Von seinem Zuhause bis zu seiner Arbeitsstelle fährt er im Schnitt 53 Minuten. Schon mehrfach wurde er gefragt, warum er nicht näher an seinen Arbeitsplatz ziehen wolle. Doch das wollte er nicht – seine Heimat verlassen? Niemals. Diese Zeit im Auto, einem durchschnittlichen Wagen der Mittelklasse, braucht er für sich. Das ist seine Zeit zum Verarbeiten. Hier ringt und kämpft er und versucht zu verstehen. Er kämpft für die Opfer, versucht ihnen die Hand auszustrecken, sie zu packen und zu greifen – ihnen aus ihrem Schlamm herauszuhelfen. Und er ringt mit den Tätern, die sich winden wie eine Feder im Wind. Immer, wenn er sie greifen will, weichen sie aus, ducken sich weg. Sie sind durchtrieben, haben alles durchdacht, und er ist immer diesen einen kleinen Schritt hinterher. Das macht ihn fertig.
Auch zu Hause lassen ihn die Gedanken an „seine Kinder“, wie er sie liebevoll nennt, nicht los. Seine Freunde bezeichnen ihn als bedächtig, als Grübler – bescheiden und unscheinbar. Doch er ist alles andere als unscheinbar. Er zählt zu den wenigen absoluten Experten in seinem Fachgebiet. Er wird zu Vorträgen eingeladen und sitzt in verschiedenen Kommissionen und Gremien. Und er ist Ansprechpartner für familiäre Sorgen weit über die Grenzen seines Dorfes hinaus.
Ab und zu, wenn er nicht weiterkommt und ihn die Bosheit zu erschlagen droht, sucht er Rat beim Höchsten höchstpersönlich. Dann geht er zum „Alten weißen Mann“, wie er ihn nennt. Peter ist nicht gläubig, aber die Vorstellung, mit einem Allwissenden zu reden, gefällt ihm. Anderthalb Stunden über einen Wanderweg hinauf zu seinem persönlichen Konferenzraum: einer kleinen Kapelle – sein Ort, um mit dem „Alten weißen Mann“ zu erörtern und zu diskutieren. Auf dem Weg dorthin bereitet er sich akribisch vor und versucht, all seine Fragen zu vereinfachen und zu präzisieren. Nach dem „Gespräch“ braucht er die Zeit, um seine Erkenntnisse zu sortieren. Er schätzt ein, ordnet zu und versucht, die Zusammenhänge zu verstehen.
Die Kapelle liegt prominent auf einer Anhöhe. Schaut man zur einen Seite, sieht man die Vorläufer der Alpen, die meist bis ins Frühjahr mit Schnee bedeckt sind. Auf der anderen Seite blickt man in die Täler mit den kleinen Dörfern, durchzogen von den schmalen Schlangenlinien der kleinen Flüsse, in denen das Schmelzwasser der Gletscher aus den Bergen abfließt.
Tritt man durch die alte, knarrende Holztür in die Kapelle, nimmt man diesen alten, modrigen, nach Erde riechenden Geruch wahr. Man sieht ein paar Bänke, und an der Vorderseite der Kapelle steht ein kleiner Schrein. Es ist seltsam: Irgendjemand aus dem Tal muss diese Kapelle regelmäßig besuchen. Peter aber hat dort noch nie jemanden getroffen. Doch immer, wenn er kommt, brennt eine Kerze. Verloschen war sie noch nie. Solange sie brennt, bedeutet sie für ihn Hoffnung. Hoffnung für seine Kinder – wie unmöglich es auch erscheinen mag.
Im Hintergrund, an der Wand hinter dem Schrein, hängt ein schönes, handgemaltes altes Bild. Man sieht eine Schafherde, die ruhig und friedlich auf einer Wiese grast. Im Vordergrund trägt der Schäfer ein kleines Schaf in seinen Armen. Ein Hund läuft an seiner Seite. Neben dem Bild hängt ein größeres Holzkreuz, an dem Jesus mit Messingstiften durch die Hände festgenagelt ist. Sein Körper ist fast weiß. Nur ein Tuch ist um seine Lenden gewickelt, aus den Löchern in seinen Händen läuft Blut, und sein Blick ist leicht nach rechts unten gerichtet.
Es ist viele Jahre her, als Peter wieder einmal in die Kapelle ging. Damals setzte er sich ganz vorne auf eine der Holzbänke und betrachtete nur dieses Bild. Stundenlang. Etwas störte ihn, aber er konnte es nicht greifen – nicht fassen. Warum trägt der Schäfer dieses Lamm in seinen Armen? Ist es ein glückliches Lamm, dem er hilft, weil es noch zu schwach ist, um mit der Herde mitzugehen? Oder feiert der Schäfer heute Abend ein Fest mit seinen Freunden – und dieses Lamm, schön präpariert, landet auf einem Spieß über dem Feuer? Abartig, dieser Gedanke. Und er quält ihn.
Freunde
Am Anfang seiner Zeit im Jugendamt wollte Peter lernen. Er sog das Wissen in sich auf und besuchte unzählige Fortbildungen, Seminare und Vorträge. Nicht immer waren diese Veranstaltungen so geistreich, wie er sich das vorgestellt hatte – und dann ärgerte es ihn. Für ihn war das eine unnötige Verschwendung seiner Lebenszeit.
Einmal war er auf einem dieser besonders langweiligen Vorträge und war kurz eingenickt. Als sein Kopf nach unten kippte und er die Augen wieder öffnete, war er für einen Moment orientierungslos. Doch er hörte die Stimme des Redners: „So, meine lieben Freundinnen und Freunde …“ Peter hob den Kopf und sah den Redner skeptisch an. Ich dein Freund? dachte er. Du verschwendest hier meine Zeit, hast mich noch nie gesehen und nennst mich einen Freund?
Nicht einmal Harry von der Tankstelle, Berta vom Kiosk oder Josef vom Pförtnerhaus am Parkplatz waren seine Freunde. Es waren Bekannte, und er freute sich, wenn er sie sah – und das nun schon seit fast zwei Jahrzehnten. Aber Freunde? Nein. Freunde, also diese echten Freunde, auf die man sich verlassen kann. Die, die einen bedingungslos unterstützen würden. Für Peter waren Freunde Menschen, denen er vertraute und von denen er wusste, dass sie nicht nur oberflächlich eine Meinung vertraten, sondern auch seine Meinung und Ansichten respektierten. Und solche Freunde hatte er. Genau genommen waren es vier. Nein – sie waren sogar mehr als das.
Aufgewachsen war Peter auf der anderen Seite von München. Sein erster echter Freund war Michael, der Junge aus der Nachbarschaft. Sie waren ein unzertrennliches Gespann. Zuerst im Kindergarten, später in der Schule. Erst als Peter nach seinem Abitur für ein Jahr nach Peru ging, wurde der Kontakt weniger. Er hatte damals keine Ahnung, was er studieren wollte, und entschied sich schließlich, als Helfer in einer Entwicklungsstation für obdachlose Kinder im Hochland von Peru zu arbeiten. Dort lernte er diese andere Welt kennen. Bis dahin kannte er nur die schöne und friedliche Welt – und es war ein Schock für ihn, dort mit der anderen Realität konfrontiert zu werden. Als er nach einem Jahr wieder nach Deutschland zurückmusste, hatten sich die Kinder in sein Gedächtnis eingebrannt. Er fühlte sich wie ein Verräter, als er sich verabschiedete und die Kinder ihn mit Tränen in den Augen nicht loslassen wollten. Mit diesem Eindruck entschied er sich für ein Studium der Sozialarbeit.
Michael ging auf die Theologische Hochschule und ist heute Pastor der kleinen Kirchengemeinde im Dorf seiner Eltern. Begegnet man ihm, schauen einen zwei große, von Lachfalten umrandete freundliche Augen an. Er ist großgewachsen, hat breite, leicht gebeugte Schultern, und sein Kopf sitzt etwas nach vorne versetzt auf seinem langen Hals. Er ist diese Art Mensch, dem man einfach vertrauen muss. Bei ihm hat man das Gefühl, dass er einen, wenn er einen begrüßt, unter seine Schwingen nehmen will, um einen zu behüten.
Während seiner Studentenzeit lernte Peter Cornelius kennen. Beide trafen sich fast jede Woche beim Volleyballspielen in der Sporthalle am Campus. Peter war nicht der Beste, aber er war couragiert, was sein fehlendes Talent etwas kaschierte. Cornelius hingegen war sportlich – und man sah ihm an, dass er viel Wert auf die Sichtbarkeit seiner Muskeln legte, die vor allem bei der Damenwelt Eindruck machen sollten. Aber Cornelius war auch ein Mann mit messerscharfem Verstand. Das bewunderte Peter. Er selbst musste sich Dinge erarbeiten, sie sich veranschaulichen und greifbar machen, damit er sie verstand. Cornelius hingegen musste sie nur hören, und er konnte sich aus allen möglichen Quellen seines Gedächtnisses sofort die Zusammenhänge zusammensetzen. Zahlen, Fakten und Daten – das war seine Welt. Für Peter war er schon damals der erste Ansprechpartner, wenn er nicht weiterkam. Der schnellste Weg war, Cornelius dienstags nach dem Training in eine der unzähligen Studentenkneipen einzuladen. Das ersparte ihm viel Zeit – und nach und nach wuchs auch eine Vertrautheit. Erst später, als Cornelius mit seinen Liebschaften oft harte Bruchlandungen machte, wendete sich das Blatt: Dann erfand Cornelius die aberwitzigsten Gründe, um mit Peter einmal die Woche reden zu können.
Peter schaute auf die Uhr. Gerade einmal eine Stunde war vergangen – und es fühlte sich an, als hätten sie ihn hier auf dem Stuhl schon seit Tagen festgenagelt. Er versuchte, sich wieder zu konzentrieren, betrachtete die Bilder und Diagramme auf der Leinwand. Es ist ja nicht zum Aushalten, dachte er. Wenn man keine Ahnung hat, muss Wikipedia wieder herhalten. Er schweifte erneut ab.
Wieder dachte er an seine Freunde. Denn einer fehlte im Bunde: Birger, der Psychologe. Die Begegnung mit ihm könnte man als echten Zufall bezeichnen. Als die Kinder klein waren, unternahm Peter mit seiner Familie mehrmals im Jahr mehrtägige Bergtouren. Von Hütte zu Hütte, nur mit Rucksack und jedem Wetter trotzend. Abends nach dem Wandertag saß man gemütlich am Tisch des Hirtenwirts, trank das ein oder andere Bier und unterhielt sich mit den anderen Wandergenossen – oft bis spät in die Nacht. An so einem Abend saß auch Birger am Tisch. Sie kamen ins Gespräch und tauschten am Ende ihre Telefonnummern aus. Birger wohnte damals schon in München, und so verabredeten sie sich ein paar Wochen später zu einem Treffen.
Birger ist zwar Psychologe, aber ein richtig Intellektueller. Sehr belesen, ruhig und weltoffen. Betritt man seine Wohnung, betritt man eine Bibliothek. Er wohnt in einer geräumigen Altbauwohnung in der Nähe des Viktualienmarktes. Ein paar Minuten zu Fuß – und er steht mitten im Zentrum Münchens.
Ja, das waren Freunde, dachte Peter. Er blickte zum Fenster, sah die Sonne auf die Gardine scheinen und schließlich wieder zurück zum Redner. Wut stieg in ihm hoch. Mehr noch: Er verachtete den Redner. Peter stand auf, drängte sich – jedes Knie streifend – zum Ende der Reihe und verließ den Raum, nicht ohne sein Namensschild beim Hinausgehen auf den Beistelltisch zu klatschen. Dann ging er hinaus zu seiner „Bunny“ – seinem alten Moped aus Jugendtagen. Das war seine Muse. Sie war launisch und bequem, besonders wenn es kalt war. Aber mit viel Geduld und gutem Zureden brachte sie ihn – bis auf wenige Ausnahmen – immer dorthin, wo er hinwollte. Und heute wollte er ans Wasser. Er fuhr an die südliche Isar, holte sich an einem Kiosk ein Bier und legte sich in der Nähe des Tierparks auf seine Jacke an das steinige Ufer und genoss die Sonne.
November 2021 – Anzeige
Es war einer dieser typischen Novembertage, und Peter saß mit seinem Laptop in einem Café am Stachus. Er war auf einem Außentermin gewesen und hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Notizen und Gedanken immer direkt danach aufzuschreiben. So konnte er sicher sein, dass wichtige Informationen nicht verloren gingen. Kein Telefon klingelte, niemand aus seinem Kollegenkreis riss ihn aus seinen Gedanken. Und er musste keine Energie darauf verwenden, sich Termine im Gedächtnis zu behalten. Sobald sie schriftlich festgehalten waren, konnte er sie aus dem Kopf haben und sich anderen Dingen zuwenden.
Konzentriert übertrug er seine handschriftlichen Notizen und drückte auf „Speichern“. Dann nahm er seine Brille ab, rieb sich die Augen und ließ den Blick über den Stachus schweifen. Es herrschte reges Leben auf dem Platz. Er war schon lange nicht mehr hier gewesen, und ihm fiel ein Buch über die Geschichte der Stadt ein, das er vor vielen Jahren geschenkt bekommen hatte. Eigentlich heißt der Stachus offiziell Karlsplatz – benannt nach einem Kurfürsten, der so unbeliebt war, dass die Menschen den neuen Namen schlicht verweigerten. Sie blieben beim „Stachus“, abgeleitet von Eustachius, einem Wirt, der am Neuhauser Tor ein Gasthaus betrieb, dort, wo heute ein Einkaufszentrum steht. Dort fand früher das Leben statt; dort wurde gefeiert und miteinander gesprochen.
Im Gedränge erkannte Peter einige Mütter und Familien mit ihren Kindern. Er überschlug, wie viele Kinder sich wohl auf diesem Platz aufhielten – vielleicht 20 oder 30. Alles sah unbekümmert und fröhlich aus. Doch statistisch gesehen machte etwa jedes siebte Kind Erfahrung mit sexuellem Missbrauch. Allein hier wären es also zwei bis drei. Er nahm den letzten Schluck Kaffee, klappte den Laptop zu und verstaute ihn in seiner Aktentasche. Bezahlt hatte er bereits. Er stand auf und verließ das Café. Knapp zwanzig Minuten später stand er vor der Tür seines Büros, schloss auf und trat ein. Inzwischen war es dunkel geworden. Er legte die Aktentasche auf seinen kleinen Besprechungstisch und schaltete die Stehlampe ein.
Wenn man in sein Büro blickte, hätte man kaum geglaubt, sich im Raum eines Abteilungsleiters zu befinden. Es glich eher einem Spielzimmer eines Kinderhorts oder einer Kindertagesstätte. Auf dem Schrank standen Kasperl und Gretel als Handpuppen, in einem Regal Kinderbücher, und nahezu alle Flächen waren beklebt mit gemalten Bildern, Grußkarten und Fotografien. Auf dem Fenstersims lagen Holzspielzeug, Muscheln, Steine und allerlei Dinge, die Kinder interessant finden.
Peter trat noch einmal hinaus in den Gang, ging zum Wasserspender, stellte ein Glas darunter, füllte es halb und trank es in einem Zug leer. Dann füllte er es erneut, ging zurück in sein Büro und setzte sich an den Schreibtisch. Bevor er Feierabend machte, wollte er noch die Daten des Tages in die Datenbank des Amtes übertragen – dann waren sie sicher und für seine Mitarbeiter zugänglich.
Er wollte gerade gehen, als sein Mobiltelefon klingelte. Auf dem Display stand „Hauplbauer“, und Peter musste grinsen. Kontakte waren sein Kapital – und er konnte nicht anders, als Telefonnummern stets sofort zu speichern. Es war ihm lästig und unangenehm, vor Gesprächspartnern gegen die besserwisserische Autokorrektur seines Handys anzukämpfen. Früher hatte er die Einträge im Nachhinein korrigiert, aber das hatte er meist vergessen. Sein Adressbuch war deshalb voller merkwürdiger Wortkreationen. „Socirca Zacki“ etwa – die Sekretärin des Amtsleiters im Sozialministerium. Und „Hauplbauer“ war in Wirklichkeit Hauptkommissar Bauer. Peter nahm ab.
„Hallo Peter, Hauptkommissar Gerhard Bauer spricht mit dir – mit seiner eigenen Stimme.“ Peter grinste erneut. „Hallo Gerhard, jetzt bin ich doch etwas überrascht. Genau das hätte ich erwartet, wenn ich deinen Namen auf meinem Display sehe. Nur fängt mein kleiner Zeh immer an zu jucken, wenn du mich anrufst. Eigentlich wollte ich gerade Feierabend machen.“ Beide lachten.
Die erste Begegnung mit Gerhard Bauer hatte Peter in seiner Anfangszeit in der Beratungsstelle. Bauer war damals bereits leitender Kriminalkommissar im Dezernat für Sexualdelikte. Es war in den 2000er-Jahren, als das Thema Missbrauch langsam ins Bewusstsein der Gesellschaft rückte. Man begann, sich intensiver damit zu beschäftigen. Auch an medizinischen Universitäten, in Forensik und Psychologie wurde das Thema aufgegriffen. Zuvor galten solche Straftaten fast als Kavaliersdelikte – wie Kirschenstehlen beim Nachbarn. Für die Betroffenen war das fatal. Erst vereinzelt kamen Fälle an die Oberfläche, meist in der katholischen Kirche, als einzelne Opfer den Mut fassten, öffentlich darüber zu sprechen. Nur langsam verstand man die Dimensionen, die Zusammenhänge und man erkannte Muster.
Gerhard ergriff wieder das Wort, mit seinem unverkennbaren Münchner Akzent: „Ich will dich nicht lange aufhalten. Ich wollte dich nur über einen Termin informieren. Der Kurt hat mir einen gewissen Julian Beyer geschickt. Der wollte einen Missbrauch anzeigen – der allerdings schon über 30 Jahre zurückliegt. Ich war bei dem Termin etwas zu spät, und mein Kollege hatte ihm bereits die rechtlichen Grundlagen erklärt. Als ich reinkam, war er ziemlich eingeschüchtert. Erst nach ein paar Minuten konnte ich noch ein paar Informationen aus ihm herausbekommen. Ich habe ihm die Nummer vom Hofer gegeben, damit er die Sache erst einmal rechtlich klärt, bevor wir in Aktion treten. Deine Nummer habe ich ihm auch gegeben. Er erzählte von einer christlichen Gemeinschaft – und da bist du, glaube ich, der richtige Ansprechpartner.“
Kurt Bachmeier gehörte zu den Kollegen des Weißen Rings, die die Notrufnummern betreuten. Der Weiße Ring ist eine bundesweite gemeinnützige Organisation, die Opfer von Straftaten unterstützt. Neben professionellen, speziell geschulten Mitarbeitern arbeiten Ehrenamtliche mit, die den Betroffenen psychologische Unterstützung bieten und sie zu Gerichtsterminen begleiten.
Zusammen mit Bernhard Hofer waren sie zu einem eingespielten Team geworden. Hofer war Anwalt aus Überzeugung – Fachanwalt für Strafrecht, Strafverteidiger und Opferanwalt. Ihm war es wichtig, den Opfern eine Stimme zu geben. In Strafprozessen stand meist der Täter im Mittelpunkt; um die Opfer kümmerte sich kaum jemand. Nicht selten waren gerade sie juristischen Angriffen ausgesetzt, die abgewehrt werden mussten. Für seine Mandanten war Hofer mehr als ein bloßer Vertreter – er versuchte, sie darüber hinaus zu stützen.
über die Jahre hatten sie gelernt: Wenn sich ein Opfer meldete, mussten sie schnell sein. Oft war der Kontakt zu einem von ihnen der letzte Hoffnungsschimmer nach einer langen Odyssee. Gerhard fuhr fort: „Herr Bayer ist über 40. Er wird sich bestimmt bei dir melden – und Peter … er sah gar nicht gut aus.“ Es entstand eine kurze Pause. Peter legte den Kopf in den Nacken. Der Kreis seiner „Kinder“ würde sich wieder erweitern. Zwar war diese Person kein Kind mehr, aber genau das war das Tückische an dieser abscheulichen Thematik. Sie erkundigten sich noch kurz nach ihren Familien und beendeten das Gespräch.
Auf Peters Schreibtisch stand neben einem Foto seiner Familie – damals waren die Kinder noch klein – ein kleiner geschnitzter Troll. Diese putzige Kreatur hatte große Füße, einen schlanken Körper und reckte mit langen Armen ein kleines Holzkreuz in die Höhe. Auf einer Urlaubsreise hatte eines seiner Kinder ihn für Peters Büro gekauft. Für einige Minuten starrte Peter in die großen Augen dieses kleinen Fabelwesens. Das verflixte Kreuz! dachte er, und eine düstere Vorahnung beschlich ihn. Aus Erfahrung wusste er, dass Fälle im christlichen Milieu ihm alles abverlangen würden. Er verließ sein Büro, stieg ins Auto und fuhr los.
Kaum war er die ersten Meter gefahren, begann sein Gedankenkarussell. Über Julian Bayer hatte er nur sehr wenige Informationen, und doch beschäftigte ihn der Fall. Würde Bayer sich melden? Was war ihm angetan worden? Warum jetzt der Gang zum Weißen Ring? Wie schlimm war der Missbrauch gewesen? Was für ein Mensch würde da auf ihn zukommen?
Über die ganze Fahrt hinweg kreisten diese Gedanken. Erst als er das Ortsschild passierte, von der Hauptstraße abbog und vor seiner Garage stand, beruhigte sich sein Geist. Er freute sich, seine Frau zu sehen.
Sein Haus war geräumig, hell und stilvoll eingerichtet. Um ihr gemeinsames Nest kümmerte sich Katja – und Peter hielt sich dankbar heraus. Ihre Liebe war gewachsen. Katja war die Schwester eines Studienkollegen. Man begegnete sich gelegentlich, redete, ging ab und zu gemeinsam in die Stadt feiern und verlor sich wieder aus den Augen. Dennoch fühlte Peter stets eine gewisse Verbundenheit.
Erst nach Abschluss seines Studiums kreuzten sich ihre Wege zufällig am Hauptbahnhof. Er sah sie, als er die Treppe zur U-Bahn hinunterging. Unten angekommen blickte er noch einmal nach oben – doch sie war bereits verschwunden. In den folgenden Tagen bekam er sie nicht mehr aus dem Kopf. Monate später fasste er ein Herz und kontaktierte ihren Bruder, um an ihre Telefonnummer zu kommen. Schließlich rief er sie an, und sie verabredeten sich in einem Lokal. Es wurde ein langer Abend.
Als Peter die Wohnung betrat, empfing ihn Stille. Heute war der monatliche „Mädelsabend“, an dem Katja sich mit ihren Freundinnen am Stammtisch traf. Das hatte er vergessen.
Er ging in die Küche, nahm sich eine Kleinigkeit aus dem Kühlschrank und überflog beim Essen die Zeitung. Danach räumte er auf und ging ins Wohnzimmer. Manchmal legte sich eine gewisse Melancholie über ihn – heute war so ein Abend. Die Schatten verdichteten sich, und sein Körper wurde schwer. Er ließ sich erschöpft in seinen Sessel fallen.
Musik war seine Leidenschaft. Die langen monumentalen Stücke von Led Zeppelin, Mark Knopfler oder Genesis – darin konnte er sich verlieren. Das war sein Kosmos. Wenn er Musik hörte, tauchte er ein, sog die Stimmungen und Emotionen auf. Oft hörte er dieselben Titel immer wieder und vergaß Raum und Zeit. Auf einem kleinen Beistelltisch standen seine Funkkopfhörer. Er setzte sie auf, wählte „High Hopes“ von Pink Floyd und stellte auf „Titel wiederholen“. Dann lehnte er sich zurück und schloss die Augen.
Es fühlte sich gut an, als die Glocken erklangen, die Vögel zwitscherten und die Insekten summten. Als der Bass einsetzte, katapultierte ihn David Gilmour in die Vergangenheit. Sofort drängten unzählige Gedanken in sein Bewusstsein. Was war aus ihm geworden? Seine Gedanken wanderten in die Kindheit. Wie unbeschwert und sorgenfrei sie gewesen war. Früher war das Gras, wie Gilmour singt, wirklich grüner, und die Tage heller.
Die Jahre als Sozialarbeiter hatten ihn verändert. Dieses Heer der kleinen niederträchtigen Geister nagte an ihm, wollte ihn auf der Erde fesseln und in den Sumpf ziehen. Auch wenn er manchen seiner Kinder helfen konnte – er konnte ihnen die Last nicht nehmen. Er konnte Schmerzen lindern, zur Seite stehen, begleiten. Doch scheitern gehörte ebenfalls zu seinem Beruf: wenn er nicht helfen konnte, wenn Entscheidungen falsch waren oder Vertrauen nicht entstanden war. Dieser endlose Fluss brauner Brühe floss beständig und drohte, ihn mitzureißen, ihn unter Wasser zu drücken. Über 15.000 Straftaten sexueller Gewalt an Kindern unter 14 Jahren wurden jedes Jahr polizeilich angezeigt; das Dunkelfeld war weit größer. Für jedes Kind war es eine Tragödie – für die Gesellschaft war es nur eine Statistik. Aufklären, durchleuchten, Täter dingfest machen – das war seine Mission. Doch Missbrauch gab es immer und wird es immer geben. Täter lauerten nicht hinter Bäumen, um Kinder in Büsche zu ziehen. Sie brauchten ein Milieu – eine Familie, einen Verein –, das sie sich zurechtbogen. In den seltensten Fällen wusste niemand etwas; meistens hatten Menschen etwas mitbekommen und schauten weg, um ihren Ruf nicht zu gefährden. Erbärmlich und feige, fand er, diese aktiven Weggucker, während die Kinder litten.
Einmal hatte eine Kollegin ihn um Rat gebeten. Auch damals geschah der Missbrauch in einem kirchlichen Umfeld. Ein Jugendlicher wurde über Jahre von einem Pastor missbraucht. Als er jemandem in der Kirche davon erzählte, spielte man es herunter. Am Ende versuchte man, ihn mit Geld zum Schweigen zu bringen. Als Peter sich später nach ihm erkundigte, war der Jugendliche tot. Selbstmord. Trug er eine Mitschuld an diesem Schritt? fragte Peter sich seitdem. Hätte er sich einmischen und konsequenter handeln müssen?
Über eine Stunde war vergangen, und der Song lief immer noch in Dauerschleife. Er war aufgewühlt, hilflos, rastlos. Es war deprimierend, und er brauchte etwas, um zur Ruhe zu kommen. Noch immer mit den Kopfhörern auf den Ohren stand er auf, nahm sich ein Glas, zog den Korken einer breitbäuchigen Flasche und schenkte sich einen schweren, bernsteinfarbenen, torfigen Whisky ein. Mit dem Glas in der Hand trat er auf die Terrasse und blickte gedankenverloren in die Dunkelheit.
Ich
Es ist Sonntag und ich sitze in meinem Auto und fahre Richtung Heimat. Die letzten Wochen waren anstrengend gewesen, und ich hatte im Schnitt vielleicht drei bis vier Stunden Schlaf pro Nacht. Die letzte Nacht habe ich durchgearbeitet, alles getestet, geprüft und alle Szenarien durchgespielt. Am Montag wird die Konferenz der Vorstände stattfinden können. Ich habe mein Wort gegeben – und ich habe es gehalten. Vor mir liegen noch knappe 400 Kilometer. Ich fahre wie in Trance und weiß am Ende nicht wirklich, wie ich zu Hause angekommen bin.
Die Familie ist ausgeflogen. Nachdem ich eine Kleinigkeit gegessen habe, schnappe ich mir eine Wolldecke, lege mich aufs Sofa und schlafe sofort ein.
Ich spüre eine Berührung in meinem Gesicht, öffne die Augen und nehme ein helles Licht in meinem Blickfeld wahr. Über mir erkenne ich eine Person. Ist es ein Albtraum oder ist es real? Seit meiner Kindheit verfolgen mich diese Träume, in denen mich nachts Hände an meinem Körper berühren. Es sind diese Situationen, in denen ich keine Kontrolle habe – und die mich am meisten belasten. Heute fasst mich niemand mehr ungefragt an, das ist klar. Doch in diesem Moment kann ich nicht unterscheiden, ob es Realität oder Traum ist.
Schon öfter habe ich Nächte auf meinen Streifzügen durch die Wälder auf einer Parkbank oder am Bahnhof verbracht. Und es kam vor, dass Jugendliche oder Betrunkene mich zum Ziel ihrer „Unterhaltung“ machten. Mit der Zeit hatte ich gelernt: Wenn ich eine Chance haben will, muss ich laut und konsequent in die Auseinandersetzung gehen. Da ich völlig orientierungslos bin und nicht weiß, wo ich mich befinde, schaltet mein Körper auf Angriff. Adrenalin schießt durch meinen Körper. Mit einem lauten „Hey!“ greife ich der Person mit voller Wucht an den Hals und springe auf. Jetzt nehme ich eine zweite Person wahr, die ebenfalls schreiend auf mich zurennt. Um mich zu schützen, drehe ich den Angreifer rücklings vor meinen Körper, um weitere mögliche Angriffe abzuwehren. Noch immer habe ich die Person fest im Würgegriff – und ich habe Kraft, sie hätte keine Chance.
Erst jetzt versuche ich mich wieder zu orientieren. Anscheinend sind es zwei. Das wäre machbar. Und während ich mich auf meine Verteidigung konzentriere wird meine Umgebung langsam klarer.
Ich blicke nicht in eine Straßenlaterne oder eine Bahnhofsleuchte, sondern auf unsere Wohnzimmerwandlampe. Der „Angreifer“ ist kein pöbelnder Jugendlicher – sondern meine älteste Tochter. Und die Person, die auf mich zugerannt kommt, ist meine Frau, die unsere Tochter schützen will.
Ich löse den Griff und gebe sie frei. Meine Tochter steht wie versteinert vor mir. Kein Winseln, kein Weinen. Langsam kommt meine Frau auf mich zu, nimmt sie vorsichtig in den Arm und tritt, wie vor einem wilden Tier, wieder ein paar Schritte zurück. Alle stehen unter Schock, und ich blicke in die weit aufgerissenen, schreckerfüllten Augen meiner Tochter.
Noch voll Adrenalin verlasse ich mit einem „Scheiße, Mann! Ihr sollt mir nicht ins Gesicht greifen, wenn ich schlafe!“ brüllend den Raum, gehe ins Bad und stelle mich unter die Dusche.
Delete. Enter.